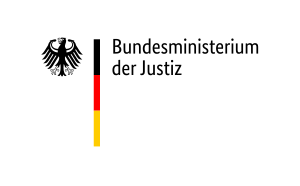Dirk WieseSPD - Sprachliche Bereinigung des Strafrechts von NS-Normen
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Aufarbeitung der NS-Zeit in Justiz und Justizverwaltung ist der Bundesregierung und allen Parteien hier im Plenum ein großes Anliegen. Sie ist viel zu lange liegen geblieben, und es erfüllt uns heute mit Scham, dass NS-Juristen nach 1945 weiter richten, lehren oder gar Gesetzestexte verfassen durften.
Zur Aufklärung und Aufarbeitung dieser Vergangenheit hat die Bundesregierung deshalb in der letzten Wahlperiode eine unabhängige wissenschaftliche Kommission beim Bundesministerium der Justiz eingesetzt, die unsere volle Unterstützung hat.
Gegenstand der Untersuchung des Rosenburg-Projektes ist vor allem der Umgang des BMJ mit der NS-Vergangenheit in den 50er- und 60er-Jahren. Dem Namen „Rosenburg-Projekt“ liegt der damalige Amtssitz des Ministeriums auf der Bonner Rosenburg zugrunde. Als Vorbild dieser Aufarbeitung dienen die Untersuchungen der NS-Geschichte des Auswärtigen Amtes.
Bundesminister Heiko Maas hat an diesem Dienstag eine weitere wichtige unabhängige Kommission eingesetzt, die das Ziel hat, die Tötungsdelikte im Strafgesetzbuch zu reformieren. Diese Reform ist aus meiner Sicht längst überfällig.
(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Sie wurde bereits seit vielen Jahren angemahnt. Wir brauchen aus meiner Sicht eine breite Diskussion darüber. Grund für den Reformbedarf sind historische wie auch praktische Gründe bei der Anwendung der Tötungsdelikte, die ich kurz erläutern möchte. Mord und Totschlag entsprechen so, wie sie in den §§ 211 und 212 des Strafgesetzbuchs definiert sind, nicht der grundlegenden Systematik des StGB; denn diese Delikte sind täterbezogen und nicht tatbezogen. Konkret heißt das, dass der geltende Mordparagraf nicht beschreibt, wann eine Tat ein Mord ist, sondern er beschreibt durch die Formulierung einen Menschentypus, der aufgrund von moralisch aufgeladenen Gesinnungsmerkmalen wie dem der niedrigen Beweggründe oder dem der Heimtücke ein Mörder ist.
Diese täterbezogene Systematik entspringt dem Gedankengut der Nationalsozialisten. So verwundert es auch nicht, dass einer der furchtbarsten NS-Juristen jener Zeit, Roland Freisler, berüchtigt als Präsident des sogenannten Volksgerichtshofs, in seiner davorliegenden Zeit als Staatssekretär im Reichsjustizministerium an der Gesetzgebung maßgeblich beteiligt war. Seiner Feder entstammt die Struktur des § 211 StGB mit der einleitenden Formulierung: „Mörder ist …“, sowie das Tatbestandsmerkmal der niedrigen Beweggründe.
Nach Vorstellung der Nationalsozialisten hatte die Strafe – damals Tod durch Erhängen statt der heutigen lebenslangen Freiheitsstrafe – auch den Zweck – ich zitiere –, „durch Ausmerzung ungeeigneter Elemente die rassenmäßige Zusammensetzung des Volkes zu ändern“ – Zitate Ende. Nach der Auffassung von Freisler und der Nationalsozialisten war die Aufgabe des Richters im Verfahren, nur noch zu bestimmen, welcher Tätertyp „den Strang verdient“. Das verdeutlicht: Hier zeigt sich die Willkür, die den damaligen Gerichtsverfahren anhaftete, ja die damals geradezu gewollt war.
Neben diesen rechtshistorischen und systematischen Gründen gibt es aber auch eine Vielzahl von Problemen in der Anwendung der Tötungsdelikte. Lassen Sie mich dies vielleicht an zwei Beispielen verdeutlichen, die in der Praxis aus meiner Sicht sehr viele Probleme bereiten:
Erstens, das sogenannte Haustyrannendilemma. Ein Ehemann, der seine Frau regelmäßig verprügelt und eines Tages sogar totschlägt, kommt bisher womöglich mit Totschlag davon, also mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe, wenn er bei Begehung der Tat kein Mordmerkmal verwirklicht hat. Die Ehefrau, die jahrelang unter der ehelichen Gewalt gelitten hat und eines Tages die ständige Prügelei und die Demütigungen durch ihren Mann nicht mehr aushält und ihn im Schlaf umbringt, bekommt automatisch lebenslänglich, da die Tötung eines Schlafenden als heimtückisch gilt und damit immer als Mord geahndet werden muss. Dass die körperlich unterlegene Ehefrau gegen den viel stärkeren Ehemann vielleicht keine andere Chance hatte, als ihn im Schlaf zu töten, dass Heimtücke also die einzige Möglichkeit der schwächeren Person sein kann, bleibt in diesem Sinne juristisch völlig unberücksichtigt.
Um diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, hat ein Landgericht – das war eine mutige Entscheidung – in genau einem solchen Fall die Strafe der Frau wegen außergewöhnlicher Umstände gemildert. Das entspricht zwar dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden, ist aber ein Milderungsgrund, der so nirgendwo im Gesetz zu finden ist und nur auf richterlicher Rechtsfortbildung basiert.
Als zweites Beispiel für praktische Probleme in der Anwendung der Tötungsdelikte sei hier der Fall genannt, dass ein Mann seine Ehefrau tötet, weil sie ihn verlassen hat, und sich nun die rechtliche Frage stellt, ob das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe in diesem Fall erfüllt ist oder vielleicht nicht. Die Rechtsprechung differenziert hier danach, ob aus Verzweiflung oder Wut getötet wurde, und hält die Wut im Gegensatz zur reinen Verzweiflung für einen niederen Beweggrund. Unabhängig davon, ob diese Differenzierung tauglich ist, bleibt festzustellen, dass auch diese Abgrenzung so nicht dem Gesetzestext zu entnehmen ist und ebenfalls auf richterlicher Rechtsfortbildung basiert. Aber gerade bei den höchsten Rechtsgütern, die hier betroffen sind, muss das Recht in den Gesetzestexten aus meiner Sicht präzise normiert sein.
(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Kurzum: Es ist aus meiner Sicht die Aufgabe des Gesetzgebers, die Grenzen strafbaren Verhaltens scharf zu bestimmen, und die Aufgabe der Justiz, die Gesetze einzelfallgerecht anzuwenden. Deshalb sind wir der Auffassung, dass hier der Gesetzgeber handeln sollte, um die Konstruktionsfehler endlich zu beseitigen und Rechtsklarheit zu schaffen, damit keine juristischen Verrenkungen an der Grenze der richterlichen Rechtsfortbildung mehr nötig sind, um zu Ergebnissen zu kommen, die auch dem Gerechtigkeitsbedürfnis der Allgemeinheit entsprechen.
Unser Ziel ist es deshalb, die Tötungsdelikte im Strafgesetzbuch noch in dieser Legislaturperiode zu reformieren. Der Bundesminister der Justiz hat deshalb eine Expertenkommission eingesetzt, um eine fundierte Diskussionsgrundlage für die parlamentarische Diskussion zu schaffen. Die Gruppe hat diesen Dienstag ihre Arbeit aufgenommen und besteht aus Fachleuten des Ministeriums sowie aus Praktikern und Wissenschaftlern, aber auch aus Vertretern der Polizei. Ich bin mir sicher, dass wir in diesem Hause bald einen gelungenen Entwurf beraten werden, und ich freue mich auf die fraktionsübergreifende parlamentarische Diskussion hierzu.
Was den Antrag der Kolleginnen und Kollegen von der Linken angeht, kann ich nur eines sagen: Wir teilen das Ziel der Bereinigung des Strafgesetzbuchs im Hinblick auf Vorschriften aus der NS-Vergangenheit; keine Frage. Nur, in der konkreten Vorgehensweise wählen wir an dieser Stelle einen anderen Weg. Denn wir wollen jetzt erst einmal die zwei bereits eingesetzten Kommissionen ihre Arbeit machen lassen. Die Neugestaltung der Tötungsdelikte muss in Ruhe angegangen werden, sie muss gut durchdacht sein. Momentan sollten diese beiden Kommissionen erst einmal ihre Arbeit machen, dann kann man möglicherweise über Weiteres nachdenken. Aber jetzt sind wir erst einmal an dem Punkt, dass diese beiden Kommissionen ihre Arbeit erledigen müssen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Das hat die Einsetzung am Dienstag gezeigt.
Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Vielen Dank, Herr Kollege Wiese. – Letzter Redner in der Debatte Alexander Hoffmann für die CDU/CSU- Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
| Source | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Cite as | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Retrieved from | http://dbtg.tv/fvid/3440674 |
| Electoral Period | 18 |
| Session | 36 |
| Agenda Item | Sprachliche Bereinigung des Strafrechts von NS-Normen |