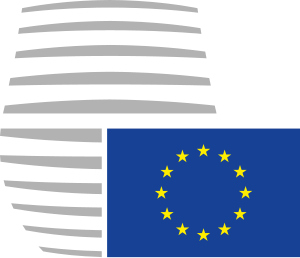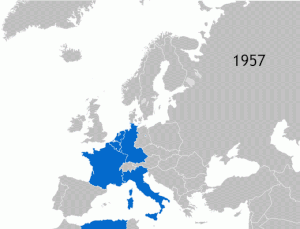Michael StübgenCDU/CSU - Auswärtiges Amt
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte versuchen, in wenigen Sätzen die Ergebnisse der Europawahl – sie ist inzwischen schon ein paar Wochen her – etwas genauer zu analysieren.
Vor der Europawahl ist viel diskutiert worden, viele Bedenken sind geäußert worden; denn diese Europawahl stand unter einem besonders schwierigen Vorzeichen. Wir befinden uns nach wie vor – hoffentlich – am Ende der sogenannten Euro-Finanzierungskrise. In der Europäischen Union gibt es eine ganze Reihe sogenannter Euro-Krisenländer. Obwohl wir die Stabilität des Euro nach außen hervorragend sichern konnten, ist es eindeutig, dass gerade in den Euro-Krisenländern die fiskalischen, sozialpolitischen und arbeitsmarktpolitischen negativen Folgen noch längst nicht überwunden sind.
Wenn Menschen Zukunftsangst haben, die Arbeitslosigkeit enorm hoch ist, die Jugendarbeitslosigkeit aufgrund fehlender Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen grassiert und alte Menschen Angst um ihre Renten haben, dann passiert es oft, dass diese Menschen eher rechten und linken Populisten folgen, die scheinbar einfache Antworten haben und natürlich mit dem Finger auf andere zeigen, die an allem angeblich Schuld sein sollen.
Deshalb haben viele, auch ich, vor dieser Europawahl Bedenken gehabt. Das Ergebnis dieser Europawahl ist eindeutig: Vier Fünftel der in ganz Europa gewählten Abgeordneten gehören Parteien und Gruppierungen an, die sich eindeutig für Europa einsetzen. Diese Abgeordneten gehören ganz unterschiedlichen politischen Familien an und haben ganz unterschiedliche politische Überzeugungen, aber sie sind für Europa. Wenn eine Wahl in einer solchen Krise so ausgeht, zeigt das für mich ganz deutlich: Das ist ein Stabilitätsbeweis für die Europäische Union. Die Menschen in Europa wollen Europa. Das ist ein gutes Ergebnis dieser Europawahl.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. Doris Barnett [SPD])
Ich möchte noch kurz auf die Wahlergebnisse in zwei Mitgliedsländern eingehen, die mich doch etwas überrascht haben, weil sie eben nicht typisch waren. Das erste Land ist Großbritannien; es ist schon einige Male genannt worden. In Großbritannien hat die Partei UKIP – sie nennt sich UK Independence Party – immerhin 27 Prozent der Stimmen bekommen. Sie verfolgt als einziges Ziel – das ist der einzige politische Inhalt –, im Europaparlament dafür zu sorgen, dass Großbritannien möglichst schnell aus der Europäischen Union austritt.
Worin liegen die Ursachen dafür, dass es in Großbritannien dazu kommen konnte? Meine Überzeugung ist: Neben der historisch bedingten Tatsache, dass die Insellage und ein erhöhtes Selbstbewusstsein – Stichwort: ehemaliges Empire etc. – dazu geführt haben, dass Großbritannien mental eher unabhängiger agiert als zentraleuropäische Länder, liegt ein wesentlicher Grund darin, dass alle politischen Führungen der letzten 20 Jahre, ob David Cameron oder vor ihm Gordon Brown, ob Tony Blair, John Major oder Maggie Thatcher – ihr Verhalten in Fontainebleau ist dafür geradezu beispielhaft –, während ihrer Regierungszeit immer meinten, dem Volk in erster Linie mit europakritischen Tönen kommen und sagen zu müssen, was in Europa alles nicht funktioniert.
Ich meine nicht, dass wir über das, was in Europa nicht funktioniert, nicht diskutieren sollten; das tun wir in diesem Haus sehr oft. Aber wenn man nicht voranstellt, wie wichtig und gut Europa ist, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass die Menschen dann einer Partei folgen, die sagt: Dann machen wir diesem europäischen Elend ein Ende.
(Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Herr Seehofer?)
Großbritannien braucht politische Führung für Europa. Das ist entscheidend. Es reicht nicht, ein Referendum darüber zu machen, ob man in Europa bleiben will oder nicht. Vielmehr muss sich die politische Klasse zu Europa bekennen. Ich hoffe, dass das noch geschehen wird. Das, was David Cameron jetzt im Zusammenhang mit der Nominierung des Kommissionspräsidenten macht, ist das Gegenteil von politischer Führung.
Ich will noch kurz auf das Wahlergebnis in Frankreich eingehen. In Frankreich hat eine dezidiert rechtsradikale und antieuropäische Partei, der Front National, 25 Prozent der Stimmen bekommen. Die regierenden Sozialisten sind weit abgeschlagen dahinter gelandet. Aber auch die konservative Partei konnte nicht von der Schwäche der Regierungspartei profitieren.
Worin liegen hierfür die Ursachen? In Frankreich fanden 2012 Präsidentschaftswahlen statt. Die Franzosen – das ist eindeutig – wollten Sarkozy nicht mehr haben. Der Präsidentschaftskandidat Hollande hat in seinem Wahlkampf – daran können sich die meisten sicherlich erinnern – den Fehler gemacht, den Menschen das Blaue vom Himmel zu versprechen: früheres Renteneintrittsalter – auf der Höhe der Euro-Krise wohlgemerkt –, höhere Renten, höhere Löhne und höheres Arbeitslosengeld. Er wurde gewählt, mit einem fulminanten Ergebnis.
Mittlerweile haben die Franzosen in den vergangenen zwei Jahren allerdings gemerkt, dass es in Frankreich nicht nur nicht besser, sondern kontinuierlich schlechter wird. Neben der Tatsache, dass es jedem Politiker gerade im Wahlkampf eine Lehre sein sollte, nicht so zu agieren und nichts zu versprechen, was man nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit umsetzen kann, entwickelt sich dies alles auch zu einem gefährlichen europäischen Problem.
Frankreich ist das letzte Euro-Land, das faktisch noch nicht mit Fiskal-, Arbeitsmarkt- und Sozialreformen angefangen hat. Deshalb wächst seit vier Jahren in Frankreich die Arbeitslosigkeit kontinuierlich, ohne auch nur ein einziges Mal rückläufig zu sein. Sie wächst Jahr um Jahr, Monat um Monat. Das Haushaltsdefizit vergrößert sich. Frankreich ist im Defizitverfahren und wird es weder in diesem noch im nächsten Jahr schaffen, sein Defizit abzubauen.
Es wird nicht ausreichen, darüber zu reden, ob wir den Fiskalvertrag ändern bzw. aufweichen können und ob es möglich ist, dass ein Land mehr Zeit braucht. Natürlich können wir das. Das beinhalten schon die bestehenden Regeln. Entscheidend ist, dass Frankreich jetzt mit Reformen beginnt.
Es ist nicht nur eine französische Krise. Wir alle wissen spätestens seit der Euro-Finanzierungskrise, dass die Finanzmärkte, was die Risikobewertung von Euro-Staatsanleihen angeht, manchmal jahrelang vor sich hinschlummern, ohne etwas zu merken und zu ändern.
Wir wissen aber auch und haben es alle bei Staatsanleihen erlebt, dass die Kapitalmärkte dann ganz plötzlich rabiat, ohne jede Vorwarnung und nicht angemessen, sondern absolut hysterisch reagieren. Das ist eine Gefahr für ganz Europa. Deswegen halte ich es für notwendig, dass wir einerseits die Flexibilität des Fiskalvertrags und des Stabilitäts- und Wachstumspaktes auch für Frankreich nutzen. Andererseits müssen aber auch die neue Kommission bzw. der Europäische Rat dafür sorgen, dass die Reformpolitik in Frankreich beginnt. Sonst werden die nächsten Jahre für uns und auch für die Europäische Union sehr schwierig sein.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Vielen Dank, Herr Kollege Stübgen. – Letzter Redner in der Debatte: Dr. Christoph Bergner für die CDU/ CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/3565875 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 42 |
| Tagesordnungspunkt | Auswärtiges Amt |