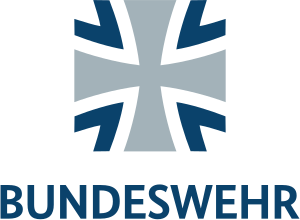Ulla Schmidt - Aktionsplan "Zivile Krisenprävention"
Guten Morgen, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In ungefähr drei Stunden werde ich in Richtung München zur Münchner Sicherheitskonferenz abreisen, wo wir – Sie ahnen es – eine Debatte über die Lage in der Welt und über die Vielzahl und Gleichzeitigkeit ernsthafter Krisen rund um den Erdball führen werden. Natürlich werden wir über die ganz akuten Krisen diskutieren, die uns alle miteinander beschäftigen: Syrien, Irak, Libyen, und über die, die uns geografisch am nächsten ist, die in der Ukraine.
Ich sage das, weil wir in München vermutlich nicht über die Vielzahl der verhinderten Krisen reden werden. Aber das macht die Arbeit der Krisenprävention, über die wir heute Morgen reden, nicht weniger wichtig. Das Paradox der Prävention ist: Am erfolgreichsten ist sie immer dann, wenn sie niemand bemerkt, wenn eben keine Bilder von Krieg und Gewalt die Fernsehbildschirme zu Hause erreichen. Vielleicht hat sich gerade dann aktive Außenpolitik in diesem Sinne für Krisenprävention gelohnt.
Deshalb sage ich zu Anfang: Wir dürfen gerade inmitten von Krisen nicht nachlassen, den Krisen von morgen vorzubeugen. Das ist meine Überzeugung, und dafür müssen wir arbeiten.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Viele im Hause erinnern sich – das dürfte inzwischen mehr als zehn Jahre her sein –, dass die damalige Bundesregierung den Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ auf den Weg gebracht hat. Das war schon damals dringend notwendig, und ich freue mich darüber, dass das Engagement für diesen Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik zugenommen hat. Allein die Haushaltsansätze im Auswärtigen Amt haben sich seit der Zeit – ich habe dieser Tage einen Blick darauf geworfen – ungefähr verzehnfacht. Im laufenden Haushalt stehen ungefähr 150 Millionen Euro zur Verfügung, die wir hoffentlich im Laufe der Legislaturperiode mit Ihrer Hilfe mindestens verstetigen können.
Damit wird etwas möglich – deshalb ist mir das wichtig – jenseits des aktuellen Krisenmanagements. Dies wird zwar weiter erforderlich sein, aber es wird zudem etwas möglich, was ich gerne unter der Überschrift der vorsorgenden Außenpolitik zusammenfasse. Das ist nicht nur die passende Überschrift für den Aktionsplan Zivile Krisenprävention, sondern auch, wie ich finde, für den mutigen Dienst der vielen Hundert zivilen Experten aus Deutschland in Friedensmissionen rund um den Globus, für das Engagement des Zentrums für Internationale Friedenseinsätze und auch für die Arbeit der Friedensforschungsinstitute, die Krisenfrüherkennung und zivile Lösungsansätze erforschen. Deshalb möchte ich in dieser Rede all denjenigen, die hier genannt sind, auch einmal meinen Dank und den Dank des Hohen Hauses sagen.
(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Damals vor zehn Jahren – ich erinnere mich zurück – haben wir durchaus bewusst mit dem Begriff der vorsorgenden Außenpolitik Anleihe an manche innen- und sozialpolitische Diskussionen genommen, die wir hier im Lande auch vor ungefähr zehn Jahren – ein bisschen länger ist es her – geführt haben. Damals haben wir gesagt: Lieber früh ins Bildungssystem investieren als später zu viel in Arbeitslosengelder. Oder: Lieber früh in die soziale Stadt investieren als später in eine dann notwendige Kriminalitätsbekämpfung.
Genau aus diesem Ansatz bzw. dieser Annäherung ist auch der Begriff der vorsorgenden Außenpolitik entstanden, bei dem man immer vorneweg sagen muss: Natürlich gibt es keine Garantie für den Erfolg. Es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass immer da, wo wir mit vorsorgender Außenpolitik unterwegs sind, auch tatsächlich keine Krisen ausbrechen. Nur eines bleibt, glaube ich, richtig: Man sollte lieber vorsorgend, gezielt und flexibel in Stabilität und Frieden investieren, um nicht spät oder zu spät eingreifen zu müssen. Deshalb müssen wir auch die Debatte fortführen, die seit dem letzten Jahr mit größerer Intensität über Verantwortung in der Außenpolitik in Deutschland läuft. In München wird das ganz sicher geschehen; sie wird dort – wie aber auch hier und in anderen öffentlichen Foren – geführt werden.
Sie wissen: Ich stehe für einen Instrumentenkasten der Außenpolitik, den man tatsächlich auch in seiner ganzen Bandbreite anwenden sollte. Dieser Werkzeugkasten ist viel reichhaltiger gefüllt, als das in der öffentlichen Debatte immer wieder gesagt wird. In München oder anderswo könnten jetzt wieder Stimmen laut werden, welche die Außenpolitik auf die Ultima Ratio verkürzen und deshalb die Alternativen „entweder endloses fruchtloses Geschwätz“ oder „Auslandseinsätze der deutschen Bundeswehr“ aufmachen. Das sind die falschen Alternativen.
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Dazwischen gibt es viel mehr Instrumente, denen wir uns zuwenden müssen.
Worum geht es wirklich bei vorsorgender Außenpolitik und Krisenprävention, liebe Kolleginnen und Kollegen? Dabei geht es vor allen Dingen um die Stärkung von Staatlichkeit. Das ist ein mühsames Geschäft, und manchmal sieht man nach fünf oder zehn Jahren den Erfolg, den wir uns wünschen, immer noch nicht. Diese mühsame Arbeit bleibt aber notwendig, weil wir wissen, dass die fragilen Staaten von heute – da, wo staatliche Strukturen zu erodieren drohen – die Krisenstaaten von morgen werden. Deshalb müssen wir diese Staaten im wahrsten Sinne des Wortes ertüchtigen. Das können wir nicht in erster Linie mit Waffenlieferungen machen, sondern vor allen Dingen durch Stärkung von staatlichen Funktionen wie Justiz, Verwaltung, Gesundheit und Bildung. Das ist der Grund dafür, weshalb wir – das wird in der deutschen Öffentlichkeit nicht diskutiert – zum Beispiel in Tunesien, Burundi und Niger sowie im Tschad in Polizeiausbildung investieren. Wir wollen ein Mindestmaß an Sicherheit für die dortige Bevölkerung erreichen.
Gernot Erler ist jetzt nicht hier. Er könnte sich aber gut erinnern, dass wir vor wenigen Jahren mit einer frühzeitigen Investition – durch Beratung bei der Koalitionsbildung in Kenia nach der damaligen Wahl – vielleicht sogar eine bürgerkriegsähnliche Situation verhindert haben, indem wir zu verhindern halfen, dass der selbsternannte Gewinner und der vermutete Verlierer der damaligen Präsidentschaftswahl in eine gewaltsame Auseinandersetzung miteinander gerieten. Wir kümmern uns auch weiterhin um Kenia – ein Land, in dem die Lage, wie Sie wissen, immer noch nicht einfach ist. Wir bauen in diesem Land jetzt eine Kammer für Völkerstrafrecht am Obersten Gerichtshof auf. Das ist Stärkung von staatlichen Institutionen. Es ist Einübung in justizielle Verfahren sowie in Verlässlichkeit von Verwaltung. Das braucht unendlich viel Zeit und Geduld. Wir müssen hoffen, dass sich das lohnt.
Diese Stärkung von staatlichen Funktionen versuchen wir auch bei der Bewältigung der Folgen der syrischen Flüchtlingstragödie zu berücksichtigen. Warum? Weil wir auf die Flüchtlinge achten müssen, denen wir humanitäre Hilfe zuteilwerden lassen müssen. Das ist klar, und dafür steht dieses Hohe Haus auch. Dafür haben wir Mittel zur Verfügung gestellt – mehr als andere Staaten. Außerdem müssen wir immer wieder auch sehen, dass die Nachbarstaaten, insbesondere Jordanien und der Libanon, unter dem Ansturm der Vielzahl der Flüchtlinge zusammenzubrechen drohen.
Im gemeinsamen Interesse der Flüchtlinge und der Region, aber auch in unserem Interesse, muss uns deshalb daran gelegen sein, die staatlichen Funktionen dort zu erhalten und den Staaten auch jenseits von humanitärer Hilfe zu helfen, mit diesen Sonderbelastungen in diesen Jahren der Syrienkrise fertigzuwerden. Das tun wir, indem wir neben der humanitären Hilfe Mittel dafür bereitstellen.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Stärkung regionaler und multilateraler Strukturen. Im Rahmen der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen uns und der Afrikanischen Union zum Beispiel bilden wir afrikanische Polizisten für Peace-Keeping-Operationen aus. Daneben unterstützen wir die Afrikanische Union bei einem ganz wichtigen Großprojekt, das nicht sehr bekannt ist: Die Afrikanische Union hat vor, bis zum Jahre 2017 umstrittene Grenzverläufe in Afrika zu identifizieren, die Grenzen zu markieren und sie möglichst zwischen den Staaten zu vereinbaren. Das verlangt technische Unterstützung, aber auch eine Umsetzungshilfe, an der wir uns ebenfalls beteiligen.
Ein dritter Schwerpunkt ist die Friedensmediation, damit Gesellschaften in Post-Konfliktstaaten nicht erneut in Gewalt abgleiten, wenn der eigentliche Konflikt vorüber ist. Dazu zwei Beispiele:
Erstens. In der nächsten Woche werde ich, wenn die Dinge so laufen, wie ich mir das wünsche, in Südamerika sein – am Schluss der Reise auch in Kolumbien. Bei dem Versöhnungsprozess, der in Kolumbien jetzt hoffentlich ansteht, stehen wir auf Bitte des Präsidenten Santos Calderón, der vor wenigen Wochen hier in Berlin war und um Unterstützung gebeten hat, beratend zur Seite. Wir nehmen ganz konkrete Projektvorschläge dorthin mit, die wir gemeinsam mit der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen entwickelt haben. Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit der Max-Planck-Stiftung für Internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit eine Zusammenarbeit beim Thema Übergangsjustiz vorbereitet. Auf diese Weise versuchen wir, auch präventiv etwas gegen das Wiederaufflammen der Auseinandersetzungen in Kolumbien beizutragen. Auch das ist Krisenprävention.
Zweitens. Wenn diese Debatte vorbei ist, werde ich eine Delegation aus Korea treffen, mit der wir bereits im November gesprochen haben und die ein neues Interesse an den deutschen Erfahrungen mit der Wiedervereinigung hat. Wir werden heute Mittag gemeinsam mit den koreanischen Kollegen darüber debattieren und später in einer zweiten Sitzung mit der deutsch-koreanischen Beratergruppe – Hartmut Koschyk und Markus Meckel sind dabei – zu diesem Thema tagen. Gemeinsam mit dieser deutsch-koreanischen Beratergruppe werden wir dann zum zweiten Mal zum Thema Wiedervereinigung zusammensitzen.
Sie haben gestern hier im Deutschen Bundestag über die Ausbildungsmission in Mali diskutiert. Das ist gut und richtig. Richtig finde ich auch, dass die breite Unterstützung des Deutschen Bundestages gewährleistet ist.
Ich sage das nur, weil viel weniger häufig zur Kenntnis genommen wird, wie breit unser politisches Engagement in Mali wirklich ist. Wir unterstützen dort zum Beispiel auch ein neugeschaffenes Ministerium für Versöhnung. Die Versöhnungsarbeit kann dort noch nicht richtig laufen, weil der Konflikt noch heiß ist, aber wir versuchen, jetzt die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Versöhnungsprozesse später schnellstmöglich anlaufen können.
Ich nenne Ihnen diese wenigen Beispiele auch, um den falschen Eindruck zu vermeiden, dass die Außenpolitik in diesen Tagen nur mit den vier, fünf Großkrisen rund um die Welt beschäftigt ist. Darauf müssen wir uns sicherlich konzentrieren. Die Öffentlichkeit hätte wenig Verständnis, wenn wir uns davon abwenden. Aber Krisenprävention, Friedenskonsolidierung oder Versöhnungsprozesse sind auch Teil meiner täglichen Arbeit bzw. des Auswärtigen Amts genauso wie Friedensmediation. Dazu haben wir gerade im letzten Spätherbst in Berlin eine große Konferenz durchgeführt. Wir wurden gebeten, noch mehr in die Ausbildung von Friedensvermittlern zu investieren. Das ist wichtig, keine Frage.
Mit einem letzten Blick auf die vielen Krisen der Welt sage ich noch einmal: Nicht überall gelingt zivile Krisenprävention. Aber ich glaube fest daran: Vorausschauende Außenpolitik ist jeden Euro wert. Ihre Rendite zahlt sich zwar heute nicht in Geldscheinen aus, aber vielleicht morgen in vermiedenen Konflikten, und das ist viel wert.
Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Vielen Dank, Herr Minister. – Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort Kathrin Vogler.
(Beifall bei der LINKEN)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/4552195 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 86 |
| Tagesordnungspunkt | Aktionsplan "Zivile Krisenprävention" |