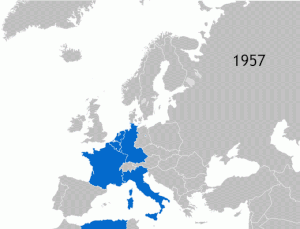Ute Finckh-KrämerSPD - Aktionsplan "Zivile Krisenprävention"
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Gäste auf der Tribüne! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Von dem russischen Schriftsteller Marschak gibt es ein Gedicht über ein vermutlich fiktives Gespräch zwischen ihm und seinem Enkel, das er 1957 veröffentlicht hat. Er fragt in diesem Gedicht seinen Enkel, was dieser gerade spielte. Er erhält die Antwort: U-Boot-Krieg. Als er dem Enkel vorschlägt, nicht Krieg, sondern Frieden zu spielen, läuft der Enkel los, kommt aber schnell wieder zurück: Großvater, wie spielt man Frieden? In der letzten Strophe des Gedichts schreibt Marschak, dass man aufhören müsse, mit dem Krieg zu spielen, damit die Kinder lernen könnten, Frieden zu spielen.
Wir wissen alle: Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg, und zum Frieden gehörten nicht nur die Stärkung rechtsstaatlicher Strukturen und Prinzipien und die Förderung von politischen Versöhnungsprozessen, die Außenminister Steinmeier in seiner Rede eben ausführlich beschrieben hat, sondern auch das friedliche Zusammenleben der Menschen vor Ort. Es geht darum, diejenigen zu unterstützen, die sich innerhalb ihrer Gesellschaft für Frieden und Versöhnung und für die gewaltfreie Austragung von Konflikten einsetzen.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN)
Dazu gibt es seit 2001 das Förderprogramm zivik – Zivile Konfliktbearbeitung –, das aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes finanziert und vom Institut für Auslandsbeziehungen, ifa, inhaltlich und organisatorisch getragen wird. Zivik fördert Projekte, die von oder zusammen mit ausländischen Projektpartnern entwickelt werden. Eines der Glanzlichter von zivik ist die Ausstellung „Peace Counts“ über Friedensstifter. Diese Ausstellung wurde unter anderem in Sri Lanka, in Mazedonien, in der Elfenbeinküste, auf den Philippinen, in Russland, mehrfach in Indien, in Kolumbien, in Jordanien, in Afghanistan und in Armenien gezeigt – jeweils organisiert zusammen mit lokalen Partnerorganisationen und verbunden mit einem Begleitprogramm, auch und gerade für Schülerinnen und Schüler. Auch Theaterworkshops, Film- und Kunstprojekte mit Jugendlichen, die auf diese Weise lernen, sich aktiv für den Frieden in ihrem Land und die gewaltfreie Austragung von Konflikten einzusetzen, werden von zivik gefördert, zum Beispiel in Armenien. Es werden auch Organisationen unterstützt, die das oft hohe Gewaltniveau in Familien und Gemeinden nach Ende eines Bürgerkriegs senken wollen, zum Beispiel in Südafrika und Kolumbien. Das ifa bietet im Rahmen von zivik an, Abgeordneten vor ihren Reisen mit Ausschüssen oder Parlamentariergruppen Informationen zu Projekten in den Reiseländern zu geben und Projektbesuche zu ermöglichen. Dieses Angebot sollten wir alle nutzen.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Auch die Menschen, die Projekte des Zivilen Friedensdienstes durchführen, würden sich über Abgeordnetenbesuche freuen, zum Beispiel das Projekt im Libanon, von dem Kathrin Vogler eben gesprochen hat. Die Projektverantwortlichen wünschen sich darüber hinaus eine verlässliche mittelfristige Unterstützung. Nach Einschätzung der für das Libanon-Projekt Verantwortlichen sind fünf bis zehn Jahre notwendig, unabhängig davon, wie sich der syrische Bürgerkrieg entwickelt. Wir wissen aus anderen Konflikten, dass Kriegsflüchtlinge auch nach Kriegsende nur sukzessive in ihre jeweilige Heimat zurückkehren können. Die Konflikte, die sich im Libanon derzeit wieder verschärft haben, erledigen sich auch nicht von selbst. Dafür müssen wir daher eine Möglichkeit finden.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der LINKEN)
Eine weitere wichtige Institution, die in den letzten zehn Jahren aufgebaut wurde, ist die Arbeitsgemeinschaft Frieden und Entwicklung, FriEnt. Sie ist eine Public-private-Partnership besonderer Art, ein Zusammenschluss von staatlichen Organisationen, kirchlichen Hilfswerken, zivilgesellschaftlichen Netzwerken und politischen Stiftungen. Hier wird Krisenprävention und Friedensförderung fast tagtäglich weiterentwickelt, werden Ideen und Erfahrungen zwischen Politik und Praxis ausgetauscht, zum Beispiel zu so vielfältigen Themen wie Landkonflikten, Transitional Justice oder der Frage, welche Ansätze in der Friedensarbeit sich als wirksam erwiesen haben und welche nicht. Regelmäßig finden runde Tische zu Krisenregionen statt, zum Beispiel zu aktuellen Konfliktgebieten wie Syrien, Ägypten und Mali, aber auch zu den vergessenen Konflikten in Kenia, in Indonesien, in Nepal und im Südkaukasus, die derzeit nicht im Fokus der öffentlichen Debatte stehen.
Wir haben darüber hinaus eine aktive deutsche zivilgesellschaftliche Fachöffentlichkeit wie die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, die den Aktionsplan gefordert hat, im Beirat zum Aktionsplan mitarbeitet, Stellungnahmen zu den Umsetzungsberichten formuliert und im ständigen Dialog mit dem Unterausschuss für Zivile Krisenprävention steht. Erstmals haben wir eine gemeinsame Stellungnahme von vier zivilgesellschaftlichen Netzwerken erhalten: der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, dem Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe, VENRO, dem Forum Menschenrechte und dem Konsortium Ziviler Friedensdienst. Außerdem liegt uns eine Stellungnahme der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung, GKKE, und des Beirats zum Aktionsplan vor. Wir als Unterausschuss haben alle diese Stellungnahmen aufmerksam gelesen. Mehr Aufmerksamkeit für die Bedrohungen, denen Zivilgesellschaft in Konfliktländern ausgesetzt ist, können wir auch im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe geben.
Die Stärke des Aktionsplans von vor zehn Jahren ist, dass er deutlich gemacht hat, dass Friedensförderung eine Querschnittsaufgabe ist, zu der alle Ministerien etwas beitragen können. Seine Schwäche damals war, dass in 161 Einzelpunkten mögliche Aktionen vorgestellt wurden, aber keine übergreifende Strategie enthalten war. Insofern haben wir, Frau Brantner, tatsächlich noch eine große Aufgabe vor uns, eine deutsche Strategie für Friedensförderung und Konflikttransformation zu entwickeln.
Die Rolle des Parlaments wurde schon angesprochen. Es ist für die Finanzierung verantwortlich. Wir haben nicht nur mehr Geld für den Zivilen Friedensdienst erreicht, sondern wir haben auch mehr Geld für humanitäre Hilfe in den aktuellen Haushalt eingestellt. 2014 wurde zudem ein neuer Titel für Projekte in Ländern der östlichen Partnerschaft eingerichtet,
(Beifall bei der SPD)
der übrigens zu den 150 Millionen Euro dazuzurechnen ist, die Frank-Walter Steinmeier vorhin erwähnt hat. Auch gibt es Mittel für das ZIF und für die Transformationspartnerschaften in Nordafrika.
Wir haben Anfang November im Unterausschuss gemeinsam mit dem Innenausschuss eine Anhörung zu Polizeimissionen durchgeführt. Am 2. März werden wir uns im Unterausschuss ebenfalls öffentlich mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen für ziviles Personal im Ausland befassen. Bei der Anhörung zur Polizeimission wurde deutlich, dass Deutschland zu internationalen Polizeimissionen eher qualitativ als quantitativ beitragen kann, weil es bei uns aus guten Gründen keine militärisch organisierten bzw. dem Militär unterstehenden Polizeieinheiten wie die französische Gendarmerie oder die italienischen Carabinieri gibt. Wir können und sollen zukünftig mehr Fachleute, die ihr Praxiswissen weitergeben können, in Einsätze der Vereinten Nationen und der Europäischen Union entsenden, aber keine Hundertschaften der Bereitschaftspolizei.
Bei der Anhörung wurde auch deutlich, dass in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Internationale Polizeimissionen“ die Einsätze kompetent vorbereitet, begleitet und ausgewertet werden. Uns wurden konkrete Vorschläge vorgestellt, darunter relativ einfach zu erfüllende wie eine regelmäßige Unterrichtung des Deutschen Bundestages über die internationalen Polizeimissionen und eine Verankerung in der polizeilichen Aus- und Fortbildung, insbesondere der Führungskräfte. Ich hoffe, dass wir in der Anhörung am 2. März dieses Jahres weitere konkrete Vorschläge für den gesamten Bereich der zivilen Fachkräfte in internationalen Einsätzen erhalten.
Deutschland übernimmt 2016 den OSZE-Vorsitz. Das ist ein weiterer Aspekt von „mehr Verantwortung übernehmen“. Die OSZE hat eine entscheidende Rolle in der Ukraine-Krise gespielt. Sie ist derzeit der einzige Rahmen, in dem die Staaten in und um Europa über Sicherheitsthemen und vertrauensbildende Maßnahmen diskutieren und verhandeln können. Deswegen ist es gut, dass Deutschland 2016 den Vorsitz übernimmt und schon jetzt im Rahmen der Troika-Konstruktion der OSZE Mitverantwortung übernimmt.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie der Abg. Marieluise Beck [Bremen] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Debatte leistet einen Beitrag zu dem, was sich die Fachöffentlichkeit lange gewünscht hat: zivile Konfliktbearbeitung und Friedensförderung öffentlich sichtbarer zu machen. „ Mission Frieden“ hat die Süddeutsche Zeitung gestern in Vorschau auf unsere heutige Debatte getitelt. Das nehmen wir gerne auf.
Danke schön.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Vielen Dank. – Nächster Redner ist Thorsten Frei, CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/4552474 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 86 |
| Tagesordnungspunkt | Aktionsplan "Zivile Krisenprävention" |