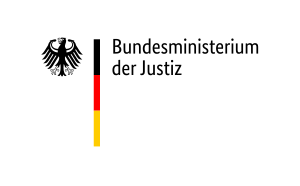Ansgar HevelingCDU/CSU - Provenienz verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, dass wir die Gelegenheit haben – der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen gibt uns diese Gelegenheit –,über das Thema Provenienzforschung zu reden und deutlich zu machen, was in den letzten Monaten dazu vonseiten der Bundesregierung schon getan worden ist. Vieles von dem, was Sie, Frau Kollegin Schauws, angesprochen haben, ist richtig. Vieles ist aber schon in der Umsetzung.
Das Thema Provenienzforschung kam zum Ende des vorvergangenen Jahres unerwartet und mit voller Wucht auf uns zu. Gleich zu Beginn der Wahlperiode hatten wir damit ein Thema auf der politischen Agenda, das zuvor nicht im Zentrum der kulturpolitischen Vorhaben und Planungen für die 18. Wahlperiode gestanden hatte. Mit dem spektakulären sogenannten Schwabinger Kunstfund, der auch als Fall Gurlitt Ende November 2013 durch die Weltpresse ging, rückte das Thema Raubkunst und Provenienz von Kunstwerken in privaten Sammlungen, aber auch in öffentlichen Museen und Sammlungen in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion und des politischen Interesses. So hat unsere Kulturstaatsministerin, Kollegin Professor Monika Grütters, kaum neu im Amt, das Thema Provenienz und Raubkunst umgehend zu ihrer Priorität gemacht.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Innerhalb kurzer Zeit hat sie kluge Entscheidungen getroffen und wichtige Maßnahmen für dieses Thema auf den Weg gebracht. Darauf werde ich im Folgenden noch weiter eingehen.
Zunächst einmal bestehen zwei Handlungsfelder bei der Frage, wie mit dem sensiblen Thema Provenienzrecherche und Raubkunst umzugehen ist: Wir können und müssen auf der einen Seite kulturpolitische Entscheidungen treffen, es gibt aber auf der anderen Seite auch noch eine rechtspolitische Dimension. Als Kulturpolitiker konzentrieren wir uns natürlich zunächst einmal auf die notwendigen kulturpolitischen Schlussfolgerungen und Handlungsnotwendigkeiten, die sich aus dem ergeben, was vor anderthalb Jahren aufgefallen ist. Die wichtigen juristischen Fragen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Raubkunst stehen zunächst einmal auf einem anderen Blatt. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht ebenso wichtig ist, sich auch diesen Fragen zu stellen und gegebenenfalls auch auf diesem Feld nach Antworten zu suchen.
Das Land Bayern, das beim Schwabinger Kunstfund sehr schnell im Zentrum des Geschehens stand, hatte dem Bundesrat bereits einen ersten Vorschlag unterbreitet. Die bayerische Initiative für eine rechtspolitische Reaktion war im Kontext der politischen Debatten sicherlich ein erster Anstoß, den wir auch auf Bundesebene dankbar wahrgenommen haben. Das ist allerdings ein Aufgabenbereich, über den sich der Bundesjustizminister vertieft Gedanken machen muss und bei dem er nach Lösungen, so sie denn notwendig sind, suchen muss.
Durch den Schwabinger Kunstfund wurde Deutschland mit berechtigten Fragen konfrontiert. Es geht um die Aufarbeitung des breiten Kunstraubs durch die Nationalsozialisten, aber auch um individuelle Schicksale von Einzelpersonen oder ganzen Familien. Diese Opferbiografien müssen einerseits anerkannt, andererseits aber auch nach den Prinzipien der Washingtoner Erklärung umgesetzt werden, die eine faire und gerechte Lösung für alle Beteiligten postuliert. Da sind wir alle hier im Hause, glaube ich, einer Meinung.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Der Fall Gurlitt hat deutlich gemacht, vor welch großen Herausforderungen wir sowohl in juristischer Hinsicht als auch bei dem Thema Provenienzrecherche an dieser Stelle stehen. Die Bundesregierung hat vier wichtige Maßnahmen getroffen, um auf diese Herausforderung zu reagieren: die Gründung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, die deutliche Erhöhung der Bundesmittel für die Provenienzrecherche, die Einrichtung einer Taskforce speziell zur Klärung des Schwabinger Kunstfundes sowie die Vereinbarung mit der Stiftung Kunstmuseum Bern über das Erbe von Cornelius Gurlitt. Mit diesen Maßnahmen ist es gelungen, in die Offensive zu gehen. Deutschland hat gegenüber der internationalen Opfer deutlich gemacht, dass es die Aufarbeitung von Kulturgutverlust insbesondere aus der Zeit des Nationalsozialismus sehr, sehr ernst nimmt und handelt.
Lassen Sie mich auf die Maßnahmen im Einzelnen eingehen. Die wichtigste Maßnahme zur Verbesserung der Provenienzforschung in Deutschland und zur Restitution von Kulturgut, das bedingt durch die Verfolgung durch die Nationalsozialisten entzogen wurde, ist sicherlich die Gründung des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste. Kollegin Schauws hat dies eben begrüßt, so wie wir alle diese Gründung begrüßen. In der vergangenen Woche hat sich der Stiftungsrat des neuen Zentrums mit seiner Vorsitzenden, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, konstituiert. Das Zentrum ist auch ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in dieser Frage. Beide Seiten leisten ihren jeweiligen Beitrag in einer gemeinsamen Stiftung. Das Zentrum Kulturgutverluste soll der zentrale Ansprechpartner für die gemeinsamen Anstrengungen der deutschen Restitutionspraxis werden, insbesondere eben auch im Bereich der NS-Raubkunst.
Ein weiteres wichtiges Element im Engagement der Bundesregierung ist die signifikante Erhöhung der Mittel. Im vergangenen Jahr hat der Bund die Mittel für Provenienzforschung bereits auf 4 Millionen Euro verdoppelt. In diesem Jahr werden dann schon 6 Millionen Euro bereitgestellt. Damit haben wir die Bundesmittel seit dem Jahr 2012 verdreifacht.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Das zeigt, dass die Große Koalition die Notwendigkeit erkannt hat, die Provenienzforschung in Deutschland zu verbessern, und dementsprechend handelt.
Dennoch bleibt in diesem Bereich viel zu tun. Nach wie vor stellt die Provenienzrecherche vor allem für viele kleinere Museen und Einrichtungen eine große Herausforderung dar. Diese Häuser brauchen Unterstützung. Deshalb ist es gut, dass auch die Kommunen in das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste eng eingebunden sind. Kurz- und mittelfristig werden sicherlich weitere finanzielle und personelle Ressourcen nötig sein, um angesichts des großen Nachholbedarfs in deutschen Museen, den wir anerkennen müssen, die Sammlungsgeschichte öffentlicher Einrichtungen umfassend aufzuarbeiten.
Allein bei dem Thema NS-Raubkunst gibt es in grob 60 Prozent der öffentlichen Museen Bestände, die zumindest theoretisch Raubkunst umfassen könnten. Es betreiben jedoch nur 10 Prozent der Museen proaktiv Provenienzrecherche, da hier – auch das muss man anerkennen – sowohl die Mittel als auch das Personal mit dem erforderlichen Wissen an allen Ecken und Enden fehlen. An genau dieser Stelle setzt das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste an. So sollen vor allem die kleineren Häuser und Einrichtungen unterstützt werden.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste in gemeinsamer Trägerschaft von Bund, Ländern und Kommunen soll die unteilbare Verantwortung zur Aufarbeitung von NS-Kunstraub übernehmen. Nicht zuletzt konnte für den Schwabinger Kunstfund mit dem Erben Kunstmuseum Bern eine gute Einigung erzielt werden, mit der für die Zukunft eine solide Grundlage geschaffen worden ist. Die kurz nach Bekanntwerden des Schwabinger Kunstfunds eingerichtete Taskforce unter der Leitung von Ingeborg Berggreen-Merkel wird ihre intensive, gute Arbeit dazu weiter fortsetzen.
(Ulrich Petzold [CDU/CSU]: Sehr gut!)
Es war im Übrigen eine beeindruckende Leistung von Kulturstaatsministerin Grütters, diese Taskforce in der Kürze der Zeit entsprechend hochkarätig wie divergent zu besetzen und arbeitsfähig zu machen.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Sicher, es bleiben im Zusammenhang mit dem Umgang mit Raubkunst nach wie vor viele auch juristische Fragen offen. Diese fallen jedoch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kulturstaatsministerin, sondern müssen von anderen Häusern beantwortet werden. Welchen weiteren Beitrag die Länder in ihrer eigenen Zuständigkeit zur Verbesserung der Provenienzforschung leisten wollen, bleibt ihnen selbst überlassen. Der Bund ist hier jedenfalls mit gutem Beispiel vorangegangen und hat die erforderlichen Mittel in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht.
(Ulrich Petzold [CDU/CSU]: Sehr schön!)
Neben der Suche nach NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut beschäftigen sich mehrere Projekte und Einrichtungen auch mit der Aufarbeitung sogenannter entarteter Kunst. Auch die Erforschung der in der DDR sowie in der Sowjetischen Besatzungszone entzogenen Kulturgüter ist ein formulierter Auftrag des Koalitionsvertrages, womit eine weitere sensible Aufgabe in den Fokus der Provenienzforschung gerückt ist.
Deutschland hat eine besondere, bleibende Verantwortung für die Aufarbeitung des nationalsozialistischen Kunstraubs. Diese Verantwortung müssen vor allem die öffentlichen Kultureinrichtungen und ihre Träger wahrnehmen. Die gemeinsame Erklärung von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden aus dem Jahr 1999 ruft aber auch privatrechtlich organisierte Einrichtungen sowie Privatpersonen dazu auf, ihrer Verantwortung zur Umsetzung der Washingtoner Prinzipien in Deutschland nachzukommen, auch wenn sie juristisch oder völkerrechtlich dazu nicht verpflichtet sind.
Wir werden uns im Ausschuss für Kultur und Medien mit dem vorliegenden Antrag auseinandersetzen und ihn dort in angemessener Weise in seinen einzelnen Punkten beraten. Viele Punkte sind der Diskussion wert, vieles ist aber auch schon auf dem Weg.
Vielen herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Das Wort hat die Kollegin Sigrid Hupach für die Fraktion Die Linke.
(Beifall bei der LINKEN)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/4555107 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 86 |
| Tagesordnungspunkt | Provenienz verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter |