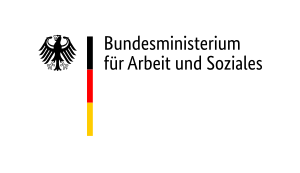Mahmut ÖzdemirSPD - Mitwirkungsrecht für Kommunen bei Gesetzgebung
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ein gutes Signal dieser Wahlperiode, dass im Plenum des Deutschen Bundestages so oft über unsere 11 200 Städte und Gemeinden und die 295 Landkreise gesprochen wird. Im Hinblick auf den Besuch von 42 Oberbürgermeistern und Stadtkämmerern als Vertreter des Kommunalen Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte“ in dieser Woche betone ich aber, dass nicht nur über die Kommunen gesprochen wird, sondern vor allem mit den kommunalen Vertretern.
(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Kerstin Kassner [DIE LINKE])
Damit ermuntern wir die Kommunen, mit uns als Bundestagsabgeordneten, aber auch in den zuständigen Landtagen zielgerichtete Gespräche für eine bessere Finanzausstattung zu führen.
Vorwegschicken möchte ich aber auch – hier rede ich ganz im Sinne des Antrages –, dass es viele Gesetzgebungsbereiche gibt, die unsere Kommunen treffen und deren Auswirkungen teilweise selbst die Fachpolitiker nicht erkennen, bevor sie nicht tatsächlich eintreten. Ich verweise beispielsweise auf die Gesetzgebungsprozesse bei der Energiewende oder beim Vergaberecht, die mitunter stark europarechtlich geprägt sind und die Kommunen vor allem personell, aber auch wegen der Komplexität von Landes- und Bundesbestimmungen treffen.
Der Antrag greift also ein durchaus diskussionswürdiges Thema auf, nämlich die verbindliche Mitwirkung der Kommunen auf Bundesebene im weitesten Sinne, um sich dann aber sogleich zwischen der Rüge über unzureichende gesetzliche Mittel und der Kritik am Grundgesetz zu verlieren. Der letztgenannten Kritik – dazu komme ich später – könnte man in der Konsequenz nur durch eine entsprechende Verfassungsänderung begegnen.
Bereits jetzt haben wir mit dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und dem Deutschen Landkreistag freiwillige ständige Vertretungen der Kommunen. Diese werden durch eine notwendige Anzahl von Aktionsbündnissen ergänzt. Die kommunalen Spitzenverbände haben bereits jetzt gemäß § 69 Absatz 5 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages – das ist eine Ist-Vorschrift – die Gelegenheit zur Stellungnahme, wenn Aufgaben ganz oder teilweise von Kommunen auszuführen oder zu finanzieren sind bzw. in die grundgesetzlich garantierte Organisationshoheit eingreifen. Dasselbe gilt im Übrigen auch für Anhörungen.
Diese Regelung einfach als unzureichend zu verwerfen, zeigt ein unbegreifliches Politik- und Selbstverständnis. Freilich kann man nach Verbesserungen und Veränderungen streben, wenn es um die kommunale Mitwirkung auf Bundesebene geht, man darf sich dann aber auch den bestehenden Möglichkeiten zunächst nicht verschließen.
(Beifall bei der SPD)
Das wäre so, als wenn ein Fußballer das Abseits für eine unzureichende Regelung halten würde und deshalb nicht mehr mitspielen möchte. Mit der inhaltsleeren Forderung nur nach Formalien ist uns an dieser Stelle auch nicht geholfen.
Was also sind unsere Spielräume? Hier ist die bestehende Geschäftsordnungsregelung zu beachten, die es uns nicht nur ermöglicht, sondern uns sogar dazu verpflichtet, bei jeder kommunalpolitisch relevanten Gesetzesberatung durch den federführenden Ausschuss die Spitzenverbände zu beteiligen. Aufgrund dieser Befugnis können wir über Fraktionen hinweg schon jetzt etwas bewegen. Für mich persönlich als überzeugtes Mitglied im Unterausschuss Kommunales des Deutschen Bundestages hat der Antrag in dieser Hinsicht durchaus einen großen Mehrwert erbracht, auch wenn wir ihn in erster Linie wegen der verfassungsrechtlichen Bedenken ablehnen werden.
Genug des Lobes! Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, ich werde es Ihnen nicht ersparen können, wiederholt darauf hinzuweisen, was ohne eine wie auch immer geartete kommunale Mitwirkung und ohne entsprechende Bemühungen in Bezug auf die Geschäftsordnung von dieser Regierungskoalition – nicht immer einvernehmlich – bundesseitig für die Kommunen bereits getan worden ist. Ich nenne die Eingliederungshilfe für Arbeitsuchende – 1,4 Milliarden Euro wurden etatisiert und sind geflossen – und die Grundsicherung im Alter mit vollständiger Übernahme der Kosten im Haushaltsjahr, wofür 5,9 Milliarden Euro voll dynamisiert veranschlagt wurden. Außerdem stellen wir als Bund den Ländern knapp 1 Milliarde Euro für Schulsozialarbeit und Kitas zur Verfügung, und der Etat für das Programm „Soziale Stadt“ wurde mit 150 Millionen Euro auf das ursprüngliche Niveau angehoben und verstetigt.
Städte, die vom Zuzug aus Südeuropa stark betroffen sind, wurden mit knapp 100 Millionen Euro für dringend notwendige ordnungspolitische Maßnahmen bedacht. Für die besonderen Herausforderungen rund um die Flüchtlingspolitik – als Duisburger weiß ich, wovon ich rede – können wir die 1 Milliarde Euro in 2015 und 2016 gut gebrauchen.
Bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung bin ich mir sicher, dass wir mit dem notwendigen parlamentarischen Druck zügig einen Gesetzentwurf auf den Tisch legen werden, um die im Koalitionsvertrag avisierten 5 Milliarden Euro an die Kommunen durchzureichen.
(Beifall bei der SPD)
Bei diesen Entlastungen darf noch lange nicht Schluss sein; das füge ich hinzu.
Übrigens darf es nicht nur um parlamentarische Beteiligung gehen. So zeigt sich überdeutlich, dass die zuvor genannten kommunalen Spitzenverbände vom BMAS beim Bundesteilhabegesetz bereits von Beginn an beteiligt worden sind, und zwar noch bevor der erste Buchstabe in den Referentenentwurf gekommen ist.
Jetzt könnte man diese Millionen und Milliarden aus den Hilfen addieren und feststellen, dass all diese, bis auf die letzte Maßnahme, innerhalb von etwas mehr als einem Jahr beschlossen worden sind und sich aktuell in Umsetzung befinden. Genauso gut könnte man aber auch feststellen, dass bei all diesen Verfahren eine kommunale Mitwirkung auf Augenhöhe bestanden hat: im Ergebnis nicht immer zur vollen Zufriedenheit der Kommunen – das gebe ich gerne zu –, wohl aber als gangbarer Mittelweg, den wir gemeinsam weiter beschreiten können.
Gerade deshalb stünde es uns bei unseren Beratungen gut zu Gesicht, bestehende Instrumente auszureizen. Nicht immer garantieren mehr Vorschriften eine bessere Qualität. Auch die beste Verfahrensvorschrift, die Beteiligungsrechte sichern soll, garantiert nicht, dass diese auch in den Ausschussberatungen wirksam zum Tragen kommen. Ich bin der Meinung, dass die Regelungen, die uns in der Geschäftsordnung des Bundestages zur Verfügung stehen, genügen.
Fakt ist jedoch über alle Fraktionen hinweg, dass wir hiervon stärkeren Gebrauch machen könnten und sogar müssten. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass wir überhaupt kein Problem damit hätten, mehr kommunale Mitwirkungsrechte bei Beratungen des Deutschen Bundestages zu beschließen. Immerhin waren es die Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion, die eine fraktionsübergreifende Initiative zu der heutigen Formulierung der §§ 69 Absatz 5 und 70 Absatz 2 der Geschäftsordnung ergriffen hatten.
Gleichzeitig rufe ich Ihnen zu: Statt uns ewig in Formalien dahin gehend übertreffen zu wollen, wer der bessere Anwalt der Kommunen sei, sollten wir uns als Abgeordnete in unseren jeweiligen Ressorts bei jeder Berichterstattung in der gesetzgeberischen Praxis diese Aufgabe, nämlich Anwalt der Kommunen zu sein, zu eigen machen.
(Beifall bei der SPD)
Deshalb macht die Wiederauflage dieses Antrags aus der 17. Wahlperiode in der aktuellen Wahlperiode schlichtweg keinen Sinn. Das möchte ich Ihnen aber auch anhand von verfassungsrechtlichen Gründen gerne erläutern.
Hier gibt es zwei Ebenen, die im Antrag betroffen sein könnten: einerseits die verfahrensrechtliche Ebene im Bundestagsbetrieb und andererseits die verfassungsrechtliche Verortung der Kommunen im Staatsorganisationsrecht. Vermengt man aufgrund von politischen Zielvorstellungen beide Ebenen und fordert eine Art kommunales Mitwirkungsgesetz, so hilft man dem Fundament unserer bundesstaatlichen Verwaltung überhaupt nicht weiter.
Die Forderung nach einem kommunalen Mitwirkungsgesetz wäre, systematisch korrekt, die Weiterentwicklung im Rahmen der Geschäftsordnung des Bundestages. Eine materiell-gesetzliche Initiative im Hinblick auf ein von Ihnen gefordertes Gesetz würde zugleich den siebten Abschnitt des Grundgesetzes und mithin die Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern und die Rolle der Kommunen an sich betreffen und käme daher einer Grundgesetzänderung gleich.
Die Kommunen besitzen aufgrund des zweigliedrigen Bundesstaatssystems zwar verfassungsrechtlich garantierte Hoheiten, aber eben keine Gesetzgebungshoheit. Damit würde der Antrag implizit einen Drei-Ebenen-Föderalismus fordern. Das heißt, der Bund, 16 Länder und die Vertretungen von Tausenden Gemeinden und Hunderten Landkreisen müssten demnächst eine Einigung finden. Das ging uns in der 17. Wahlperiode zu weit, und das geht uns auch heute noch zu weit.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Die Kommunen sind gemäß Artikel 28 Grundgesetz Gliederungen der Länder, und dies wollen wir auch beibehalten. Deshalb muss der Bund, aber müssen auch die Länder, bevor Gesetze zur Ausführung übertragen werden, die Belastbarkeit der Kommunen überprüfen. Das Ministerium für Inneres und Kommunales in Nordrhein- Westfalen hat hierzu auf eine Kleine Anfrage eine sehr dezidierte Übersicht aller kommunal erbrachten Aufgaben vorgelegt, in der deutlich wird, dass nahezu alle bundes- und landesgesetzlichen Aufgaben durch Kostenübernahme und/oder Gebühren aufgefangen werden.
Jedoch besteht in den Sozialhaushalten aufgrund der dynamisch wachsenden Kosten erheblicher Regelungsbedarf. Diesen unter anderem punktuellen Regelungsbedarf hingegen darf man nicht als großes Systemproblem hinstellen und dabei die kleinen Hausaufgaben vergessen. Zusätzliche Gelder, etwa in Form eines nationalen Investitionspaktes für Kommunen in zweistelliger Milliardenhöhe, wie Vizekanzler Gabriel ihn vorschlägt, werden weder durch solche Anträge noch durch irgendwelche Mitwirkungsrechte geschaffen. Denn unterm Strich braucht man politische Mehrheiten in diesem Haus, um so hohe Beträge für unsere Kommunen bewegen zu können. Ich sage: Das lohnt sich. Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen und nicht immer auf Landesregierungen zu schimpfen, bei denen das Geld angeblich für Haushaltssanierungen verwendet wird. Diejenigen, die gemeint sind, mögen sich jetzt bitte höflichst angesprochen fühlen.
Die bestehenden Regelungen in Verbindung mit der Arbeit des Unterausschusses Kommunales sind ausreichend. Ihnen zur Wirksamkeit zu verhelfen, ist eine parlamentarische Pflicht. Im Unterausschuss Kommunales, der beim Innenausschuss angesiedelt ist, ist es im Übrigen Praxis, dass die kommunalen Spitzenverbände stets von der Vorsitzenden eingeladen werden. Die Forderung nach einem eigenständigen Kommunalausschuss auf Bundesebene klingt für mich persönlich sehr sympathisch. Aber manchmal muss man mit dem leben, was einem zur Verfügung steht.
Zusammenfassend: Alle Abgeordneten haben eine Verantwortung für das gesamte Bundesgebiet, aber auch für den eigenen Wahlkreis im Einzelnen. Wenn wir dieser Verantwortung als Bundestag gemeinsam nachkommen, werden wir sicherlich über solche Anträge – unabhängig davon, aus welcher Fraktion sie kommen – demnächst nur noch müde lächeln, weil wir materiell, in der Sache gemeinsam bessere Arbeit leisten, als es uns manche formale Geschäftsordnung gestatten würde.
Hinsichtlich des Antrages möchte ich mit einem Zitat von Bertolt Brecht schließen:
Aus den dargelegten verfassungsrechtlichen und politischen Gründen, und nicht aus mangelnder grundsätzlicher Sympathie, werden wir den Antrag ablehnen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein herzliches Glückauf!
(Beifall bei der SPD und bei der CDU/CSU)
Der Kollege Helmut Brandt hat für die CDU/CSU- Fraktion das Wort.
(Beifall bei der CDU/CSU)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/4662287 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 88 |
| Tagesordnungspunkt | Mitwirkungsrecht für Kommunen bei Gesetzgebung |