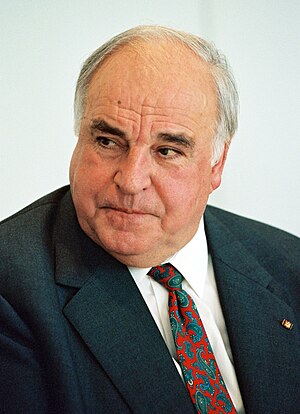Katrin Göring-EckardtDIE GRÜNEN - 50 Jahre diplomatische Beziehungen zu Israel
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Wer 50 Jahre zurückblickt, kommt nicht umhin, sich zu wundern. Mit diesem Deutschland hat Israel 1965 diplomatische Beziehungen aufgenommen: 20 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus war Deutschland weder frei von Schuld noch frei von Schuldigen. Ganz im Gegenteil: Es war eine Gesellschaft, deren Kriegsgeneration sich den Fragen ihrer Kinder nach kollektiver und individueller Schuld noch gar nicht gestellt hatte und auch nicht stellen wollte. Die in der deutschen Bevölkerung seinerzeit verbreitete Einstellung wurde vier Jahre später, im Jahr 1969, von Franz Josef Strauß so ausgedrückt – ich zitiere –:
Wie unglaublich, wie absurd, wie anmaßend – damals wie heute.
Übrigens: Die DDR hat nicht nur keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnehmen wollen; sie hat weder eine Debatte über Aufarbeitung noch über Schuld geführt. Ein antifaschistischer Schutzwall sollte dazu führen, dass die Täter auf der anderen Seite sind; eine Hypothek bis heute.
Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland war übrigens auch nicht das Resultat sorgfältiger Vorbereitung. Es war das Ergebnis einer Folge von Skandalen und Enthüllungen im Kontext des Kalten Krieges: deutsche Raketentechniker in Ägypten, geheime Waffenlieferungen von Deutschland nach Israel, die Hallstein-Doktrin, der Besuch von Walter Ulbricht in Ägypten.
In den folgenden Jahren und Jahrzehnten entstanden einerseits sehr enge und tragfähige Beziehungen in den Bereichen von Politik, Kultur, Zivilgesellschaft, Bildung und Wissenschaft. Andererseits gab es aber auch immer wieder Anlässe zu spürbaren Verstörungen in dem Verhältnis beider Länder. Das reichte von der antiisraelischen Wendung vieler Gruppen der westdeutschen Linken nach 1965, dem Terroranschlag auf die israelische Olympiamannschaft im Jahr 1972 über die sogenannte Schmidt-Begin-Kontroverse 1981 und den Israel-Besuch von Helmut Kohl 1984 bis hin zu dem umstrittenen Gedicht des gerade verstorbenen Autors Günter Grass aus dem Jahr 2014.
Dass die deutsch-israelischen Beziehungen intensiv und tragfähig wurden, ist auch, aber nicht nur das Verdienst vieler Regierungs- und Parlamentsvertreter und -vertreterinnen beider Staaten. Es ist ebenso ein Verdienst vieler Bürgerinnen und Bürger, Kirchen und Kirchgemeinden, Städtepartnerschaften, Kulturprojekte, die diese Beziehung mit Leben gefüllt haben und sie tragen, die einander auch in politisch schwierigen Zeiten vertrauensvoll verbunden geblieben sind.
Eine wichtige Arbeit hat bereits vor 54 Jahren begonnen. Ich will sie erwähnen, weil ich ihr persönlich verbunden bin. 1961 kamen die ersten Freiwilligen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste aus Deutschland nach Israel. Seit 20 Jahren kommen auch junge Israelis zu Freiwilligendiensten nach Deutschland. Die Geschichten, die die jungen Leute erzählen, sind und bleiben beeindruckend: wenn Hilfe im Haushalt plötzlich zu einer tiefen Freundschaft über mehrere Generationen hinweg wird und wenn ein alter Mann einem Helfer Dinge erzählt, die er seinen eigenen Kindern nie anvertrauen wollte. Diese Arbeit ist von unschätzbarem Wert. Je mehr die Generation der Zeitzeugen schwindet, umso wichtiger wird die Generation, die Zeugnis für die Zukunft ablegt.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD und der LINKEN)
Ich persönlich bin sehr dankbar dafür, dass wir über unsere gemeinsame Geschichte reden können. Als ich Gabriel Bach, den Ankläger im Eichmann-Prozess, in Jerusalem traf, haben wir über diese Geschichte sprechen können. Ich bin sehr froh, dass er das mit vielen Jugendlichen getan hat. Aber noch viel mehr bleibt mir sein Besuch in Berlin in Erinnerung. Im Gespräch stellten wir fest, dass meine Berliner Wohnung unweit der Straße war, in der er aufgewachsen ist. Es war Frühjahr, und er war dort. Überall sah man Geranien an den Balkonen, rote Geranien. Gabriel Bach aber hat keine Geranien gesehen. Er sah nur das Rote und dachte an die Fahnen der Nazis, die damals auf einmal aus allen Fenstern hingen.
Aktuelle Umfragen zeigen, dass eine erschreckend hohe Zahl von Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land einen Schlussstrich unter die Aufarbeitung der Vergangenheit ziehen möchte. Ihnen müssen wir widersprechen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD und der LINKEN)
Geschichte zu kennen, bedeutet, Verantwortung zu leben, ganz unabhängig vom eigenen Alter und von der Frage persönlicher Schuld. Nie vergessen ist keine Hypothek, sondern es ist das wichtigste Erbe, das wir weiterzugeben haben.
Es muss uns umtreiben, dass im vergangenen Jahr die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland um 25 Prozent angestiegen ist. Das ist für unser Land beschämend. Ich hoffe trotzdem umso mehr, dass die Menschen jüdischen Glaubens, die hier zu Hause sind, es auch bleiben. Es ist unser gemeinsames Land. Es ist unsere gemeinsame Hoffnung.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD und der LINKEN)
Herr Kauder hat eben zu Recht darauf hingewiesen, wie absurd es ist, dass eine israelische Flagge im Fußballstadion eingerollt werden musste. Natürlich hat sich der Polizeipräsident entschuldigt, und wahrscheinlich sind wir uns auch alle einig darüber, wie falsch diese Aktion war. Das Gefährliche daran ist aber die Gedankenlosigkeit, mit der das passiert ist.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD und der LINKEN)
50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Israel und Deutschland, das ist kein gegenseitiges Verteilen von Streicheleinheiten. Es ist ein gewachsenes Verständnis füreinander, das auch Kritik aushalten kann und muss, genauso wie Enttäuschungen. Die von Benjamin Netanjahu im Wahlkampf geäußerte Aussage, an der Perspektive der Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr arbeiten zu wollen, war eine solche Enttäuschung. Darum muss man nicht herumreden. Aber auch wenn es im Gebälk knirscht: Das Fundament ist stabil. Die Beziehungen sind nicht nur von Geschichte, sondern auch von Gegenwart geprägt.
Es gibt auch weiterhin viel zu besprechen in und zwischen unseren Gesellschaften. Was wir nicht brauchen, ist eine gern beschworene Normalisierung des einzigartigen Verhältnisses zwischen Israel und Deutschland. Eine Normalisierung würde nämlich die Besonderheit unseres Verhältnisses zu und unsere Verantwortung für Israel negieren. Wir feiern 50 Jahre diplomatische Beziehungen im selben Jahr, in dem wir an den 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz erinnern. Beides ist untrennbar miteinander verknüpft. Diese Erinnerung ist kein konservierendes Geschichtsbild, sondern sie ist Auftrag.
Der Blick auf die Geranien am Balkon in Charlottenburg und der Strandspaziergang unserer Kinder und Enkel in Tel Aviv: Es wird Momente geben, die eben nicht unbeschwert sind. Von daher zu den 50 Jahren beides: Schalom und Mazel tov.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei der CDU/CSU und der SPD sowie bei Abgeordneten der LINKEN)
Vielen Dank, Katrin Göring-Eckardt. – Nächster Redner: Achim Post für die SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/5038890 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 103 |
| Tagesordnungspunkt | 50 Jahre diplomatische Beziehungen zu Israel |