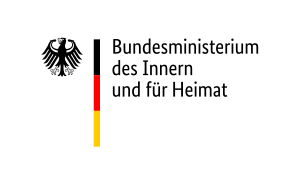Brigitte ZypriesSPD - Informationsweiterverwendungsgesetz
Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Schade, dass sich die Reihen hier so leeren; denn das Thema, über das wir reden wollen, ist ein Zukunftsthema. Damit sollte man sich befassen.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Sie wissen es: Jede und jeder von uns nutzt Apps auf Smartphones, mit denen wir Navigationshilfen finden, mit denen wir uns über das Wetter informieren und manche von uns auch über die Pollenbelastung. Wir erkundigen uns über die Fahrpläne öffentlicher Verkehrsmittel. Wir buchen unsere Tickets darüber. Wir checken uns ins Flugzeug ein. Wir informieren uns über Rechtsvorschriften und Gerichtsurteile, und wir erkundigen uns über Statistiken und Unternehmen.
Ein großer Teil dieser Anwendungen beruht auf Informationen, die von staatlichen Stellen generiert wurden und auf diese Art und Weise, also über diese Anwendungen, für alle zugänglich gemacht werden. Staatliche Informationen, deren Zugänglichkeit und Weiterverarbeitung, sozusagen Open Data, sind der Motor der digitalen Wirtschaft. Die Europäische Kommission schätzt, dass der direkte und indirekte wirtschaftliche Nutzen von Open Data europaweit in einer Größenordnung von jährlich 140 Milliarden Euro liegt. Für uns steht völlig außer Frage, dass wir das Potenzial, das in der Wirtschaftskraft der Verarbeitung dieser Daten liegt, nutzen wollen.
Um dieses Ziel besser zu erreichen, haben wir die europäische Public-Sector-Information-Richtlinie angepasst. Die neuen Vorgaben der Richtlinie setzen wir nun mit den Änderungen des Informationsweiterverwendungsgesetzes um. Dieses Informationsweiterverwendungsgesetz ist der Rechtsrahmen für die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen, soweit es nicht um spezielle Regelungen geht wie beispielsweise bei Geodaten oder bei Umweltinformationen.
Nach diesem Gesetz wird geregelt, welche Informationen weiter verwendet werden können. Die Entscheidung darüber, ob das geht oder nicht, lag bisher im Ermessen der jeweiligen öffentlichen Stelle. Das gilt jetzt nicht mehr. Die Daten sind jetzt weiterzuverwenden. Das ist der eine wesentliche Punkt der Änderung. Der zweite Punkt ist, dass wir jetzt auch den Anwendungsbereich erweitern und Museen, Bibliotheken und Archive miteinbeziehen. All dies erleichtert die Nutzung staatlicher Informationen und ist damit ein erster Schritt hin zu einer umfassenderen Open-Data-Regelung, die wir uns ja im Koalitionsvertrag vorgenommen haben und bei der der Bundesinnenminister federführend ist.
Zugleich wollen wir dafür sorgen, dass über die Register Informationen für interessierte Unternehmen leichter auffindbar sind. Dafür haben wir das Datenportal GovData geschaffen. In dieses Portal sollen alle öffentlichen Unternehmen einstellen. Wenn Sie dieses Portal im Internet aufrufen und es sich anschauen, dann sehen Sie: Es stehen schon jetzt erstaunlich viele Informationen drin. Aber das wird noch sehr viel besser werden.
Wir wollen für die Wirtschaft Anreize setzen, die Daten, die erhoben werden, auch tatsächlich zu verwenden. Ich will Ihnen ein Beispiel aus meinem anderen Zuständigkeitsbereich, der Luft- und Raumfahrt, nennen: die Sentinel-Satelliten, von denen wir den ersten letztes Jahr ins All geschossen haben. Dieser Satellit hat ein Radarsystem, und dieses Radarsystem vermisst alle sechs Tage die komplette Erdoberfläche. Einmal in sechs Tagen ist also die komplette Erde abgescannt. Damit können wir jetzt zum Beispiel erkennen, ob Eis auf dem Ozean ist oder wie das Land genutzt wird, und können alle möglichen Schlüsse daraus ziehen. Das gilt vor allen Dingen dann, wenn man bedenkt, dass es inzwischen viele junge Unternehmen gibt, die weitere Luftaufnahmen machen, indem sie unbemannte Flugobjekte wie kleine Drohnen nutzen, oder eben Luftaufnahmen aus Flugzeugen machen. All diese Daten aus der Erdbeobachtung können in unterschiedlichen Datenbanken zusammengefasst werden. Aus diesem Material können sich dann neue Geschäftsmodelle ergeben.
Es gibt beispielsweise ein junges Unternehmen in Hessen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mithilfe dieser Daten auszurechnen, wie viel Erde man braucht, um große Löcher, zum Beispiel in einem Steinbruch, mit Erde zu verfüllen. Man kann anhand der Daten von oben zum Beispiel sagen: Es fehlen noch 25 Lastwagen voll Erde, bis das Loch gefüllt ist.
Sie sehen also: Hier gibt es viele Möglichkeiten. Dazu gehören auch Apps. Diese können etwa aufzeigen, wo es nach einer Katastrophe noch Zugangsmöglichkeiten gibt. Wir konnten beispielsweise mit den Daten des DLR auch bei dem schweren Erdbeben in Nepal helfen, weil wir speziellere Daten hatten. Sie können aber auch eine App nutzen, um zu erfahren, wie Sie mit einem Rollstuhl durch die Stadt kommen; auch das beruht auf Daten, die aus der Luft aufgenommen wurden.
Das waren jetzt Beispiele aus dem Bereich der Erdbeobachtung. Es gibt natürlich viele andere Beispiele, etwa Portale, die den Zugang zu Entscheidungen der unterschiedlichsten Gerichte ermöglichen, oder in Kürze solche, die Ihnen die Inhalte von Museen in 3-D darstellen, und vieles andere mehr. Den Geschäftsmodellen und der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ich freue mich, dass es gelungen ist, das im Rahmen dieser Gesetzesänderung zu regeln.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und des Abg. Dieter Janecek [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. – Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt der Kollege Herbert Behrens.
(Beifall bei der LINKEN)
| Source | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Cite as | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Retrieved from | http://dbtg.tv/fvid/5039776 |
| Electoral Period | 18 |
| Session | 103 |
| Agenda Item | Informationsweiterverwendungsgesetz |