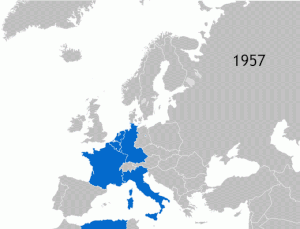Hansjörg DurzCDU/CSU - Informationsweiterverwendungsgesetz
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mir ist vor allem nach der Rede des Kollegen Behrens noch einmal wichtig, die Abgrenzung, welches Gesetz eigentlich wofür Regelungen schafft, vorzunehmen.
Wenn ein Bürger in Deutschland Informationen von einer Bundesbehörde einfordert, muss die Verwaltung darauf reagieren, muss die Daten zur Verfügung stellen, wenn keine übergeordneten Gründe dagegen sprechen. Dass jede Person einen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen von den Bundesbehörden hat, regelt das Informationsfreiheitsgesetz. Während die ursprüngliche Intention dieses Gesetzes mehr Transparenz war, kommt durch die voranschreitende Digitalisierung eine weitere Dimension hinzu: Ämter und Behörden speichern zunehmend mehr Informationen digital. Die verfügbaren Datenmengen nehmen tagtäglich zu, und auch die Technologien zur Analyse, Nutzung und Verarbeitung von Daten werden kontinuierlich weiterentwickelt.
Durch Verwenden, Aggregieren und Kombinieren von Daten entsteht die Chance, ständig neue Dienste zu entwickeln, und gerade Daten aus dem öffentlichen Sektor bergen enorme Potenziale für neue Geschäftsmodelle und auch dafür, Menschen den Alltag zu erleichtern. Die sicherlich bekannteste Form der Nutzung öffentlicher Daten findet durch Navigationsgeräte statt; dafür werden sie jedenfalls am häufigsten verwendet. Welche weiteren Möglichkeiten in offenen Daten stecken, möchte ich anhand dreier Beispiele – einige andere wurden schon angeführt – kurz erläutern:
Erstes Beispiel. Auf der Basis öffentlicher Daten entstand die Anwendung „Parken Wien“. Mithilfe dieser App lässt sich anhand der Position des Nutzers feststellen, ob dieser sich in einer Kurzparkzone befindet und ob diese aktiv ist. Zudem werden kostenpflichtige und kostenfreie Zonen in unterschiedlichen Farben angezeigt. Über die mobile Anwendung können direkt Parkscheine gelöst werden. Es werden aktuelle Daten der Stadt Wien genutzt und ständig aktualisiert. Diese Anwendung zählte bereits bei Einführung zu den meistgekauften Apps in ganz Österreich.
Ein zweites Beispiel. Die App „Bayernnetz für Radler“ ist durch die Zusammenarbeit bayerischer Ministerien entstanden und beinhaltet mittlerweile 120 Fahrradtouren mit einer Länge von insgesamt 8 800 Kilometern. Diese App verfügt über Radroutenplaner, Karten, Höhenprofile, Verknüpfungen zu Bahntransportmöglichkeiten, Veranstaltungsinformationen usw. usf. Entstanden aus Daten, die öffentlich zur Verfügung gestellt wurden, schafft die App einen Mehrwert für die Nutzer und stärkt den Radtourismus.
Das dritte Beispiel kommt aus der Landwirtschaft. Im Ackerbau kommt dem Pflanzenschutz eine hohe Bedeutung zu. Gleichzeitig ist Pflanzenschutz eine sehr informationsintensive Aufgabe. Seit längerem existieren mobile Anwendungen für Landwirte, mit deren Hilfe die Landwirte bei ihren Entscheidungen im Bereich Pflanzenschutz unterstützt werden. So können beispielsweise die täglichen Infektionsbedingungen für die wichtigsten Blattkrankheiten bei Getreide oder Zuckerrüben an einem bestimmten Standort über das Smartphone abgerufen werden. Auf diese Weise wird durch die Vernetzung verschiedener öffentlicher und privater Datenquellen wie Geo- oder Wetterdaten zusammen mit herstellerspezifischen Daten zu Pflanzenschutzmitteln die Möglichkeit geschaffen, die landwirtschaftliche Betriebsführung zu unterstützen.
Diese Beispiele zeigen: Offene Daten bergen ein großes Potenzial für Innovationen. Liegen Behördendaten als offene Daten vor, können sie von Bürgern und Wissenschaftlern, aber eben auch von Verwaltung und Wirtschaft weiterverarbeitet werden. Auf diese Weise können neue Anwendungen, Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle entstehen.
Der öffentliche Sektor erfasst, erstellt und reproduziert ein breites Spektrum an Informationen: Geodaten, Energieverbrauchsdaten, Emissionsdaten, Verkehrsdaten oder Bevölkerungsdaten. Die EU-Kommission prognostiziert – wir haben es vorhin bereits gehört – den volkswirtschaftlichen Nutzen für die 27 Mitgliedstaaten auf circa 140 Milliarden Euro pro Jahr. Dass die Nutzung von Informationen des öffentlichen Sektors ein enormes wirtschaftliches Potenzial birgt, hat die EU-Kommission bereits mit der ersten „Public Sector Information“-Richtlinie aus dem Jahr 2003 aufgegriffen. Diese Richtlinie sollte die Weiterverwendung dieser Daten erleichtern und allgemeinverbindliche Grundlagen schaffen. Deutschland hat diese Richtlinie im Informationsweiterverwendungsgesetz von 2006 umgesetzt.
Übrigens: Als das Gesetz in Kraft trat, gab es quasi noch gar keine Smartphones. Allein das zeigt schon die enorme Dynamik der Digitalisierung und gibt einen Hinweis darauf, dass eine Anpassung des Rechtsrahmens notwendig geworden ist.
Also noch einmal kurz zur Einordnung: Dass Bürger einen Anspruch auf Zugang zu Informationen und Daten des Bundes haben, regelt das Informationsfreiheitsgesetz. Dass diese Daten auch genutzt und weiterverwendet werden dürfen, regelt das Informationsweiterverwendungsgesetz.
Mit dem neuen IWG setzen wir nun die neue Richtlinie der EU aus dem Jahr 2013 in deutsches Recht um. Die entscheidende Neuerung besteht darin – wir haben es gehört –, dass Informationen öffentlicher Stellen grundsätzlich weiterverwendet werden können. Bisher musste ein Antrag auf Weiterverwendung öffentlicher Daten gestellt werden, und die öffentliche Stelle musste dann entscheiden, ob die entsprechenden Daten genutzt werden dürfen oder nicht. Jetzt gilt grundsätzlich: Was frei zugänglich ist und beispielsweise nicht durch Urheberrechte geschützt ist, darf auch weiterverwendet werden. Damit sind öffentliche Stellen nunmehr dazu verpflichtet, Informationen für kommerzielle und nichtkommerzielle Zwecke freizugeben. Wir schaffen dadurch für die Nutzer von Informationen des öffentlichen Sektors eine deutliche Erleichterung. Übrigens reduziert das Gesetz auch den Aufwand in der Verwaltung, die Weitergabe zu prüfen und einen entsprechenden Bescheid auszustellen. Wir schaffen also etwas ganz Besonderes: weniger Bürokratie für alle.
Dass es notwendig ist, Bewegung in den Bereich Open Data zu bringen, zeigt ein Blick auf den kürzlich veröffentlichten Open Government Index 2015. Hier belegt Deutschland bei der Qualität und Anzahl der zur Verfügung gestellten Informationen unter 102 Ländern nur den 18. Rang. Das bedeutet: Hier können und hier müssen wir besser werden. Mit der Veröffentlichung des „Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung zur Umsetzung der Open-Data-Charta der G 8“ im vergangenen November wurde von der Bundesregierung ein Weg aufgezeigt, wie es gelingen kann, mehr Verwaltungsdaten im Sinne von Open Data zu veröffentlichen. Das ebenenübergreifende Datenportal GovData ist dabei hervorzuheben; denn im besten Fall stellen die öffentlichen Stellen die Daten freiwillig und automatisch auf dieser zentralen Plattform zur Weiterverwendung zur Verfügung.
Doch nicht nur der Bund ist bei der Bereitstellung offener Daten aktiv. Auch bestehen auf Ebene der Länder sowie der Kommunen zahlreiche Open-Data-Plattformen. Daher ist ausdrücklich zu begrüßen, dass sich die Bundesregierung dafür einsetzt, die Nutzung des Portals GovData auch durch Länder und Kommunen zu befördern, um den Anwendern einen möglichst umfassenden Datenkatalog anbieten zu können. Gleiches gilt für den Aufbau einer europäischen Open-Data- Infrastruktur und die Bemühungen der Bundesregierung, dass sich GovData mit seinen Schnittstellen darin einfügen lässt. Der Bedeutung von GovData wird das neue IWG auch gerecht, indem es in dem neuen § 8 hervorhebt, dass Daten, die von Behörden online zur Verfügung gestellt werden, auch im nationalen Datenportal zur Verfügung gestellt werden sollen, wobei klar ist, dass dieses Portal mit Sicherheit noch etwas attraktiver für den Anwender gestaltet werden kann.
Die Novelle zum IWG heute zu verabschieden, ist ein notwendiger und absolut richtiger Schritt. Insgesamt müssen wir aber feststellen, dass wir bei Open Data noch in den Kinderschuhen stecken. Wir müssen von daher noch viele weitere Schritte gehen, um all die vorhandenen Potenziale, die in der Bereitstellung offener Daten liegen, zu nutzen. So müssen wir unter anderem Antworten auf folgende Fragen finden:
Erstens. Wie schaffen wir es, dass Daten künftig nicht nur auf Nachfrage, sondern generell vom öffentlichen Sektor auf einer Open-Data-Plattform zur Weiterverwendung bereitgestellt werden?
(Herbert Behrens [DIE LINKE]: Genau!)
Zweitens. Wie erreichen wir, dass alle öffentlichen Stellen ihre Daten in einem einheitlichen maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellten?
Oder drittens. Wie begegnen wir der Tatsache, dass der Verwaltung ein erheblicher Aufwand entsteht, wenn Daten bereitgestellt werden? Kann hier über eine Gebührenrichtlinie ein Lösungsansatz gefunden werden?
Auf diese Fragen müssen wir Antworten finden. Sie belegen, dass wir weiter an diesem Thema arbeiten müssen. Die Novellierung des IWG ist ein erster Schritt. Weitere müssen folgen. Auf jeden Fall wollen wir mit öffentlichen Daten digitale Geschäftsmodelle ermöglichen, die Wirtschaft stärken und somit Innovation und Wachstum fördern.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Vielen Dank. – Nächster Redner ist der Kollege Dieter Janecek für Bündnis 90/Die Grünen.
(Andreas G. Lämmel [CDU/CSU]: Jetzt kriegen wir ein ordentliches Lob für die Koalition!)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/5039785 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 103 |
| Tagesordnungspunkt | Informationsweiterverwendungsgesetz |