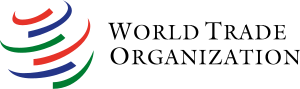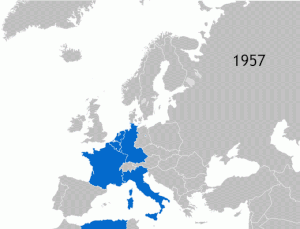Wilhelm PriesmeierSPD - EU-Richtlinie über das Klonen von Nutztieren
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kollegin Tackmann, ich kann das nachvollziehen: Ich bedauere es außerordentlich, dass es in diesem Hause nicht gelingt, bei Fragestellungen, bei denen es um ethische und moralische Ansprüche und Themen geht, fraktionsübergreifend zusammenzuarbeiten.
(Beifall der Abg. Birgit Wöllert [DIE LINKE])
Sie wissen, wie das Prozedere hier im Haus normalerweise ist. Ich kann nur an die Kollegen appellieren, dass wir uns in Zukunft bei solchen Themen vielleicht ein bisschen mehr Gemeinsamkeit gönnen; denn es geht essenziell ja nicht um eine große politische Debatte,
(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Doch, es geht um eine große politische Debatte!)
sondern darum, dass wir heute hier im Hause konstatieren können, dass wir im Deutschen Bundestag die größtmögliche Koalition gegen das Klonen zustande gebracht haben.
(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Ich freue mich über diesen gemeinsamen Antrag, zumal nach der Aktuellen Stunde im Jahre 2011, die wir dazu in diesem Hause erleben durften. Da hat hier eine ganz andere Debatte stattgefunden, auch mit Schuldzuweisungen. Ich erinnere noch: Es war der Minister Brüderle, der ein relativ aussichtsreiches Verfahren auf europäischer Ebene mit seinem Veto damals verhindert hat – auch zum Leidwesen seines damaligen Koalitionspartners. Ich erinnere auch noch an den Ausspruch vom Kollegen Holzenkamp in dieser Debatte, dass er kein Klonfleisch essen will.
(Franz-Josef Holzenkamp [CDU/CSU]: Ja!)
Das ist mir noch sehr gegenwärtig.
Mit dem Antrag setzen wir in der Großen Koalition gemeinsam etwas um, was wir in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Ich halte es für wichtig, dass man nicht nur etwas aufschreibt, sondern es auch umsetzt.
Mit den jetzt vorliegenden Entwürfen auf der europäischen Ebene soll bis 2016 mehr Rechtssicherheit geschaffen werden. Das ist dringend notwendig. Das Fleisch von Klonen wird zwar zum gegenwärtigen Zeitpunkt im europäischen Bereich nicht zur Erzeugung von Lebensmitteln verwandt, aber wer weiß denn, wie das in Zukunft ist. Die Option besteht; die Tür ist offen. Diese Tür muss dringend geschlossen werden. Auch nach der Stellungnahme der FDA und der EFSA sind die Zweifel nicht ausgeräumt worden. Im Gegenteil, bei mir sind sie noch verstärkt worden.
Das Geschäft mit dem Klonen hat nach der Entscheidung der FDA in den USA, in Kanada und in anderen Ländern begonnen. Dahinter steht nicht unbedingt die Neugierde der Wissenschaft – die würde ja zur Lösung der Probleme im Bereich der Fleischerzeugung nicht mit Klonen arbeiten –, sondern dahinter stehen natürlich Interessen, Interessen von großen Zuchtverbänden, die nicht unbedingt genossenschaftlich organisiert sind,
(Artur Auernhammer [CDU/CSU]: Genau!)
Interessen von großen Verbänden, die wertvolle Genetik haben, diese Genetik natürlich weltweit verkaufen und damit Gewinne erzielen möchten. Es gibt zwei große Unternehmen, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben: Trans Ova und ViaGen. Sie sind in unterschiedlichen Märkten tätig.
Man muss sich einmal vor Augen führen, dass von einem Unternehmen sogar Emergency Cloning angeboten wird. Das heißt, wenn ein wertvolles Zuchttier plötzlich verstirbt, wenn etwa ein Pferd nach einer Kolik am nächsten Morgen tot aufgefunden wird, dann ist, wenn ein bestimmter Zersetzungsgrad der Zellen noch nicht erreicht ist und die somatischen Zellen im Kern noch brauchbar sind, die Möglichkeit gegeben, aus diesem Tier noch einen Klon zu produzieren, um es züchterisch weiter nutzen zu können. Diese Unternehmen sind in Ländern wie Argentinien, Brasilien und Paraguay tätig. Auch in Australien und Neuseeland gibt es entsprechende Unternehmen, die sich mit Klonen beschäftigen. Da gehört schon ein bisschen Mut dazu, wenn wir auf der europäischen Ebene sagen: Das ist mit unserer Einschätzung, mit unserer Ethik und mit unserem Verständnis von Tierschutz nicht vereinbar. Deshalb dürfen wir diese Debatte nicht den Wissenschaftlern und den Unternehmen und Unternehmern überlassen, sondern müssen sie auf der politischen Ebene hier im Deutschen Bundestag führen und dazu beitragen, dass die kritischen Stimmen im Europäischen Parlament, die wir aus der letzten Debattenrunde 2011 noch kennen und die ich mittlerweile auch schon wieder vernommen habe, auch durch eine entsprechende Positionierung der deutschen Bundesregierung unterstützt werden, die das Klonen ebenfalls nachhaltig ablehnt.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Es geht dabei nicht um Wissenschaft oder Ökonomie allein. Es geht dabei um ganz grundlegende ethische Fragestellungen. Letztendlich geht es um die Schöpfung, für die wir Verantwortung tragen. Nicht alles, was die Reproduktionstechnologie heute ermöglicht, ist auch ethisch vertretbar. Ich kenne das aus eigener Anschauung: Ich habe über viele Jahre eine große Rinderpraxis betrieben, mit Besamung und in Teilen, wenn es angezeigt war, mit Embryotransfers. Mittlerweile wurden weitere Möglichkeiten entwickelt: das Embryosplitting, bei dem man Embryonen teilt, die Geschlechtsbestimmung bei Embryonen, das Aussortieren der Embryonen, die man aufgrund des Geschlechtes nicht möchte, und natürlich auch das Spermasexing. All das sind Möglichkeiten, die bislang schon – ethisch noch vereinbar – zur Verfügung stehen, aber auch dazu beigetragen haben, dass es im Bereich der Züchtung zu erheblichen Fortschritten gekommen ist. Man muss diese Technologien natürlich immer vor dem Hintergrund des ethischen Anspruches, den man hat, prüfen.
Ich glaube, angesichts dessen, was wir dort erreicht haben, braucht man gerade im Bereich der Zucht kein Klonen mehr. Kühe erreichen heute in Deutschland eine jährliche Durchschnittsleistung von 8 000 bis 9 000 Litern. Das Zuchtziel beträgt 10 000 Liter Milch mit 4 Prozent Fett und 3 bis 4 Prozent Eiweiß; andere Länder sind in Teilen ein wenig weiter. Ich glaube, vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass wir diese Technologie mit Sicherheit nicht brauchen, um die Leistung zu steigern. Im Gegenteil: Wenn wir diese Technologie einsetzen, dann schränken wir die genetische Vielfalt weiter ein, die in der Rinderzucht eh schon stark eingeschränkt ist; wir sehen einen hohen Inzuchtgrad. Auch in anderen Bereichen, in denen entsprechend intensive Zuchten betrieben werden, etwa im Bereich der Pferdezucht, ist das durchaus erkennbar. Das können und müssen wir nicht dauerhaft so hinnehmen. Ich glaube, gerade die Vielfalt ist notwendig, wenn wir auch für die nächsten Generationen Optionen offenhalten wollen.
Deshalb ist die klare Kennzeichnung von Produkten, die von solchen Klonen stammen, und von Lebensmitteln, die mit Klonfleisch hergestellt wurden, essenziell und wichtig. Das Verbot sollte nicht – wie jetzt diskutiert – nur befristet, für fünf Jahre, gelten, sondern grundsätzlich,
(Beifall der Abg. Elvira Drobinski-Weiß [SPD])
damit jedem klar ist, wofür wir in der Europäischen Union stehen. Die Gründe dagegen, etwa die Angst vor Wettbewerbsverfahren im Rahmen der WTO, finde ich nicht richtig. Das Urteil zur Nichteinfuhr von Robbenfellen wurde damit begründet, dass sozioökonomische Aspekte durchaus ein gewichtiger Grund sind, so etwas zu verhindern. Es geht hier um die gleiche Größenordnung wie beim Verbot des Imports von Hormonfleisch. Deshalb bin ich guten Mutes und der festen Überzeugung, dass es uns gelingen wird, das Verbot im Sinne der Tiere, im Sinne der Vielfalt und im Sinne des Tierschutzes in Europa umzusetzen.
Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Vielen Dank. – Als nächste Rednerin hat Nicole Maisch von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das Wort.
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/5045286 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 104 |
| Tagesordnungspunkt | EU-Richtlinie über das Klonen von Nutztieren |