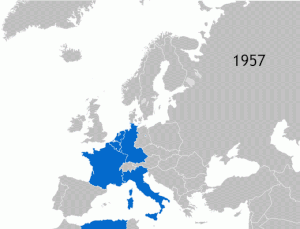Sigmar Gabriel - Wirtschaft und Energie
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn wir in dieser Woche den Bundeshaushalt 2016 beraten, dann sind die Gedanken aller hier im Parlament und die Gedanken derjenigen, die uns beobachten, nicht nur bei diesem Zahlenwerk, sondern bei der vermutlich größten nationalen und europäischen Herausforderung seit der Wiedervereinigung: 800 000 Menschen suchen Sicherheit und Lebensperspektive hier bei uns in Deutschland; Millionen Menschen sind auf der Flucht, so viele wie nie zuvor; Hunderttausende davon setzen ihre Hoffnung auf uns und rufen nach Aufnahme in Deutschland.
Alle Routine ist verschwunden. Zahl und Wucht dieser Menschenflucht haben wahrhaft historische Dimensionen. Angesichts dieser großen Herausforderung kann man schon sagen: Selten hat Deutschland so zusammengestanden wie jetzt. Das tut uns gut, und das tut den Flüchtlingen gut.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Denen, die Menschen in Not helfen, möchte ich, wie Sie sicherlich alle auch, nicht nur Respekt ausdrücken, sondern vor allen Dingen danken. Das gilt aber auch – auch das darf man einmal sagen – für die Angehörigen unseres öffentlichen Dienstes. Ich finde, die Arbeit von Angestellten und Beamten des öffentlichen Dienstes widerlegt in diesen Tagen und Wochen alle Vorurteile, die es ihnen gegenüber gelegentlich gibt.
(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Deutschland ist gefordert, aber Deutschland ist auch stark. Ohne die wirtschaftliche Stärke unseres Landes, ohne Wachstum und sichere Arbeit würden wir diese Herausforderung wohl nicht so optimistisch anpacken. Erst die wirtschaftliche Leistungskraft unseres Landes, gepaart mit soliden Finanzen, erspart uns jetzt schwere Entscheidungen und Konflikte darüber, wie wir die Aufnahme und die Integration so vieler Menschen in Deutschland schaffen und finanzieren wollen. Hätten wir in den Jahren zuvor auf die gehört, die uns aufgefordert haben, diesen soliden Pfad zu verlassen – mehr Schulden zu machen, nicht so sehr auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu achten –, hätten wir heute nicht die Kraft, ein so großes Paket für die Flüchtlingshilfe auf den Weg zu bringen, wie wir es am Sonntag getan haben, ohne dass es zu Leistungskürzungen für unsere Bürgerinnen und Bürger und zu Steuererhöhungen kommt. Dass wir gemeinsam Kurs gehalten haben, meine Damen und Herren, zahlt sich jetzt aus – für die Flüchtlinge und die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Die deutsche Wirtschaft ist auf einem soliden Wachstumspfad. Die Entwicklung in diesem Jahr zeigt, dass die Prognose der Bundesregierung von 1,8 Prozent Wirtschaftswachstum in diesem und im nächsten Jahr realistisch ist. Das zahlt sich für die Menschen aus. Auch 2015 rechnen wir mit einer steigenden Zahl von Erwerbstätigen – ausgehend von einer Rekordbeschäftigung von über 42 Millionen Menschen in Deutschland.
Das Wachstum wird auch von einer robusten Binnenkonjunktur getragen. Diese wiederum wird durch gute Tarifabschlüsse, den Mindestlohn, höhere Investitionen und übrigens auch den Verzicht auf Rentenkürzungen getragen. Dazu kommen positiv wirkende Außenfaktoren wie die Erholung der Vereinigten Staaten, der niedrige Ölpreis und der Wechselkurs des Euro.
Wachstum und Beschäftigung bringen uns auch in diesem Jahr höhere Steuereinnahmen als erwartet. Der Bund bzw. die Koalition hat am letzten Sonntag verabredet, dass wir diese gestiegene Finanzkraft jetzt einsetzen wollen, um Länder und Kommunen noch einmal dauerhaft, strukturell und übrigens auch dynamisch – und nicht, wie gestern in einem Redebeitrag gesagt wurde, einmalig – zu entlasten. Es wird eine Hilfe zur Verfügung gestellt werden, die am Ende natürlich von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen abhängig sein muss.
Länder und Kommunen brauchen diesen Beistand für die menschenwürdige Unterbringung und Versorgung, aber vor allen Dingen auch für die Integration von Flüchtlingen. Vergessen wir nicht: Von den Hunderttausenden, die zu uns kommen, werden viele auf Dauer bleiben. Wir müssen sie integrieren, und auch dem müssen wir uns gesamtstaatlich widmen.
Der Bund muss die Voraussetzungen bei der Grundsicherung des SGB II, aber auch bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik, bei Sprachkursen und bei der Qualifizierung schaffen, um eine größere Zahl von Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Hier liegen Chancen und Risiken der Zuwanderung ganz dicht beieinander. Schaffen wir es, die Menschen, die zu uns kommen, schnell auszubilden bzw. weiterzubilden und in Arbeit zu bringen, dann lösen wir eines unserer größten Probleme im Hinblick auf die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes, den Fachkräftemangel.
Deutschland hat ja ein Experiment vor sich, das noch kein anderes Industrieland der Erde hat schaffen müssen. Bis 2030 werden wir 6 Millionen Arbeitskräfte weniger haben – 6 Millionen Menschen, die nicht für die Erarbeitung unseres Wohlstands am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen werden. Das ist nicht nur eine Gefahr für die betroffenen Unternehmen vor allem im Mittelstand und im Handwerk, sondern auch eine Gefahr für den Wohlstand der ganzen Gesellschaft; denn alternde Gesellschaften wachsen langsamer, sind weniger innovativ und verlieren an wirtschaftlicher Dynamik.
Die Zuwanderer, die jetzt kommen, können uns helfen, das zu ändern. Wenn es gut läuft, wenn wir es gut machen, dann nutzen wir einen Willen, den alle diese Menschen haben, nämlich zu einem besseren und sicheren Leben zu kommen. Sie haben Kinder bei sich, denen sie das versprechen wollen, was uns unsere Eltern versprochen haben, nämlich: Du sollst es einmal besser haben als wir. – Wenn wir es schaffen, das zu nutzen, wenn wir sie zu gleichberechtigten Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes machen, dann erinnern wir uns vielleicht auch selbst an manche der Tugenden, die wir in unserem Land haben. Manchmal verschwinden dann vielleicht auch ein bisschen Trägheit und Selbstzufriedenheit.
Die, die kommen, können uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bereichern, wenn sie Bürgerinnen und Bürger dieses Landes werden. Aber auch das Risiko liegt auf der Hand. Kümmern wir uns zu spät um Sprachausbildung, suchen wir nicht nach der Qualifikation der Menschen, die zu uns kommen, und lassen wir sie monatelang oder noch länger untätig bleiben, dann werden die Integrationsprobleme wachsen.
Dann werden aus Leistungsträgern Leistungsempfänger. Ich appelliere deshalb an die Unternehmen, die Wirtschaftsverbände und die Kammern, gemeinsam mit Betriebsräten, Gewerkschaften und mit uns in der Bundesregierung eine Ausbildungsinitiative für Flüchtlinge zu starten. Zu einem entsprechenden Gespräch haben wir schon eingeladen.
(Beifall bei der SPD)
Fragen Sie in den Unternehmen ihre Meister und ihre Ausbilder! Diese wissen, was man braucht, um Menschen, die noch nicht über ausreichende Qualifikationen verfügen, anzulernen.
Die Bereitschaft vieler Unternehmen, jetzt zu helfen, ist groß. Ich habe ein wunderbares Erlebnis gehabt. Ein mittelständischer Industrieller, der in diesem Jahr 66 Jahre alt wurde, hat mich gefragt: Was kann ich eigentlich machen, um zu helfen? Ich habe ihm gesagt: Du musst Ausbildungsplätze schaffen. Einen Tag später hat er 66 neue nur für Flüchtlinge geschaffen. Das ist ein großartiges Beispiel.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und der Abg. Dr. Petra Sitte [DIE LINKE])
Wir müssen Sprachkurse anbieten und die Anerkennung von Abschlüssen weiter beschleunigen. Wir müssen die richtige Nachqualifizierung finden, und wir müssen umdenken. Flucht und Asyl dürfen nicht jahrelanges Nichtstun bedeuten. Ausbildung und Arbeit sind die beste Integration. Integration und soziale Teilhabe bedeuten vor allem auch Kindertagesstätten- und Schulplätze sowie bezahlbarer Wohnraum, übrigens für alle, die ihn brauchen, nicht nur für Flüchtlinge.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Bund, Länder und Kommunen werden in den kommenden Jahren das damit verbundene Ausgabenwachstum spüren. Das ist keine einmalige Angelegenheit. Wir müssen die Ausgaben nicht nur in diesem und im nächsten Jahr, sondern auch in den nächsten fünf, zehn Jahren absichern. Deshalb müssen wir vor allem in der Wirtschaftspolitik neue Anstrengungen unternehmen. Denn klar ist uns allen: Nur eine Wirtschaft, die wächst, kann einen Staat und eine Gesellschaft finanzieren, die so große Aufgaben wahrnimmt. Schaffen wir das nicht, werden Verteilungskonflikte entstehen und wird der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ganz schnell in Gefahr geraten. Die Bundesregierung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft weiter nachhaltig zu stärken. Wir erhöhen Investitionen. Wir bauen Bürokratie ab. Wir entlasten Bürgerinnen und Bürger und stärken die Kommunen.
Die Bundesregierung hat die öffentlichen Investitionen erhöht. Das wollen wir fortsetzen und haben das in Haushalts- und Finanzplanung verankert. Bis einschließlich 2019 werden die investiven Ausgaben des Bundes jährlich bei rund 31 Milliarden Euro liegen; vor ein paar Jahren waren das noch etwas mehr als 20 Milliarden Euro. Das wird auch private Investitionen auslösen und die Konjunktur stützen. Zu den herausragend wichtigen Zukunftsinvestitionen zählen natürlich in allererster Linie die Digitalisierung, ihre Infrastruktur und vieles andere, was damit zusammenhängt. Aber ich zähle auch die im Rahmen unserer Klimaschutzziele vorgesehene Steigerung der Energieeffizienz dazu. Diese ökologische Modernisierung senkt den CO 2 -Ausstoß. Sie senkt aber zugleich auch Kosten und erhöht unsere Wettbewerbsfähigkeit. Die Bundesregierung wird deshalb sicherstellen, dass die Mittel des Bundes für die Energieeffizienz auf Rekordhöhe steigen.
Wir werden außerdem mit dem Gesetzespaket zum neuen Strommarkt mehr Markt und Wettbewerb bei der Energiewende ermöglichen. Auch das wird Wirtschaftlichkeitsreserven heben und Kosten senken. Übrigens sind die Strompreise in diesem Jahr gesunken. Die EEG-Umlage ist zum ersten Mal seit 15 Jahren gefallen, und zwar ohne dass wir, wie manche behauptet haben, einen dramatischen Einbruch bei den erneuerbaren Energien zu verzeichnen haben.
(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Photovoltaik! Biogas!)
– Herr Krischer, bei der Windenergie hatten wir 2,5 Gigawatt vorgesehen. Wir lagen letztes Jahr, glaube ich, bei 4,7 Gigawatt.
(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Was ist 2017?)
Das ist nicht gerade ein Einbruch, Herr Krischer. Ich bin sicher, dass die Entwicklung bei der Solarwirtschaft ähnlich verlaufen wird, wenn wir die Förderung wieder verstetigen.
(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Aha!)
– Das tun wir, unter anderem mit den Ausschreibungsmodellen, die übrigens exzellent laufen, ganz im Gegensatz zu Ihren Prognosen.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Es beteiligen sich Energiegenossenschaften und Bürger.
(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Keine einzige Genossenschaft hat ein Projekt gewonnen!)
– Sir, Sie wissen ganz genau, dass wir erst vor der zweiten Runde stehen. Ich finde das eigentlich gut: Sie machen die Prognose, und wir zeigen später, dass sie nicht stimmt. Das ist schon okay.
(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Auch bei der regionalen Strukturpolitik stellen wir in Ost und West mehr Geld für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ zur Verfügung. Die Lage in Ostdeutschland hat sich in den letzten 25 Jahren natürlich drastisch verbessert, aber nicht gut genug. Deshalb wird es über das Jahr 2019 hinaus nötig sein, die strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands weiter zu fördern.
Die Förderprogramme des Wirtschaftsministeriums dafür wachsen auf. Die Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ werden von 580 Millionen Euro im Jahr 2013 auf jetzt 600 Millionen Euro erhöht. Davon gehen übrigens 80 Prozent in die ostdeutschen Bundesländer. Beim Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand sind es immerhin 42 Prozent.
Auch der hier im Haus so umstrittene Kompromiss mit der Braunkohlewirtschaft hat etwas mit der Unterstützung Ostdeutschlands und mit Strukturpolitik insgesamt zu tun. Ja, wir haben im Wirtschaftsministerium, wie wir finden, ein nach wie vor relativ preiswertes Instrument – die Klimaabgabe – zur Erreichung der CO 2 -Ziele bis zum Jahr 2020 entworfen. Aber wir haben jetzt eine Alternative gewählt. Und ja, die Alternative zum Erreichen dieser Ziele ist teurer. Wir erreichen die Ziele genauso wie mit der Klimaabgabe. Aber es stimmt: Die Alternative ist teurer; sie kostet deutlich mehr Geld. Die stärkere Förderung von KWK, die Sicherung der Existenz der Stadtwerke und auch die Begleitung des Strukturwandels in der Braunkohle kosten Geld. Aber das Risiko einzugehen, dass es zu Strukturbrüchen in der Braunkohle kommt, hätte uns noch viel mehr Geld gekostet.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der CDU/CSU)
Ob es wirklich klug ist, zu sagen: „Wir in der Politik mit unseren Gutachten wissen das am Ende besser als die, die vor Ort das Risiko tragen“, wenn sich herausstellte, dass man sich geirrt hat? Da waren wir eben anderer Meinung.
(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Vom Paulus zum Saulus!)
10 000 Arbeitsplätze sind keine Kleinigkeit für Regionen, die den Schock der Deindustriealisierung nicht vergessen haben. Die vergütete Stilllegung von Braunkohlekraftwerken senkt die CO 2 -Emissionen erheblich; aber sie kostet Geld – klar. Außerdem hilft sie den Unternehmen und den Beschäftigten, den Strukturwandel sozial sicher zu vollziehen. Wer dagegen ist und dagegen polemisiert, dem rate ich, mal hinzufahren und mit den Menschen zu reden.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Die Zukunft unserer Unternehmen und unseres Landes liegt in den Investitionen, natürlich auch in Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Dafür haben wir mit Professor Fratzscher Vorschläge entwickelt, die im November dieses Jahres ins Kabinett kommen, damit wir sie umsetzen können.
Unsere Wirtschaft wird aber nur stark bleiben, wenn auch die privaten Unternehmen mehr investieren. Die Nettoinvestitionsquote deutscher Unternehmen muss einem seit mehr als zehn Jahren große Sorge machen; sie ist nämlich viel zu niedrig. Dafür wollen wir die Rahmenbedingungen weiter verbessern. Es geht um mehr Innovationen, um Fachkräftemobilisierung, um das Lösen von Investitionsbremsen. Das Bürokratieabbaugesetz schafft eine Entlastung von 700 Millionen Euro. Für die Mobilisierung von Venture Capital für die Wachstumsphase von Unternehmen verabschieden wir gemeinsam mit dem Finanzministerium in diesen Tagen die Vorschläge.
Von der günstigen Wirtschafts- und Finanzentwicklung profitieren auch die Bürgerinnen und Bürger vor allen Dingen durch sichere Beschäftigung und ordentliche Löhne. Große Ungleichheit, sagen IWF, OECD und jetzt auch das Weltwirtschaftsforum, behindert und blockiert eine Wirtschaft. Mehr Chancen und bessere Zugänge für mehr Menschen hingegen vergrößern das Wachstumspotenzial. Die Entwicklung der Reallöhne in Deutschland ist gut. Im vergangenen Jahr sind die Löhne je Arbeitnehmer um knapp 4 Prozent gestiegen. Ordentliche Tarifabschlüsse, Tarifbindung, mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stehen dahinter. Das ist gut und muss weitergehen.
Verteilungsfragen sind soziale und wirtschaftliche Zukunftsfragen. Wir können ein durchlässiges Bildungssystem am Ende nur finanzieren, wenn wir dafür die Kraft und die Mittel haben. Also geht es immer wieder auch um eine gerechte und faire Steuerpolitik. Insbesondere die in Europa nach wie vor existierende Ungerechtigkeit beim Steuerzahlen müssen wir beseitigen. Es kann nicht sein, dass sich große Konzerne vor einem angemessenen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens drücken können.
(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Bartholomäus Kalb [CDU/CSU])
Wer nach dringend notwendigen Reformen in Europa fragt, der hat hier eine Antwort: Die großen Konzerne müssen endlich mehr zahlen, damit wir die mittleren und niedrigen Einkommen von der zu hohen Last der Steuern und Sozialabgaben, die Weltwirtschaftsforum, OECD und andere kritisieren, entlasten können. Europa ist nicht durch Griechenland in Gefahr, sondern durch den wachsenden nationalen Egoismus seiner Mitgliedstaaten.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der CDU/CSU)
Wenn wir den nicht überwinden, dann werden wir die Menschen von der europäischen Idee nicht mehr überzeugen können.
Insofern müssen wir den Blick auch auf die Zukunft und die vor uns liegenden zehn Jahre richten. Wir müssen eine Vorstellung davon entwickeln, wovon wir 2025 leben wollen. Wir müssen die Quellen unserer wirtschaftlichen Stärke beachten. Im Inland geht es um höhere Investitionen – aber wahrlich nicht nur in Beton, Glasfaser und Maschinen –, vor allen Dingen aber geht es um die Menschen, die wir hier haben: soziale Teilhabe, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, übrigens auch gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit;
(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Josef Göppel [CDU/CSU])
denn die Art und Weise, wie wir Menschen in Pflegeberufen bezahlen – schlecht nämlich –, ist der eigentliche Grund, warum wir dort Nachwuchssorgen haben.
(Zuruf der Abg. Jutta Krellmann [DIE LINKE])
– Ich glaube schon, dass das so ist.
Das gilt im Inland wie übrigens auch in der internationalen Vernetzung; denn die internationale Vernetzung ist die zweite Quelle unseres wirtschaftlichen Wohlstands. Deutschland bekommt jede internationale Krise zu spüren. Wo sich Märkte verschließen, droht unsere Produktion zu erlahmen. Ukraine, Russland, Strukturprobleme, Börsenturbulenzen in China, Wachstumsschwäche in Schwellenländern, Unsicherheiten in der Eurozone und in Europa – wenn alles zusammenkommt, ist unsere wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr sicher.
Deshalb glaube ich: Zusammenhalt, Stabilität und Vertiefung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist in unserem vitalen Interesse. Der Kollege Schäuble hat richtigerweise gefordert, dass sich die Mitgliedstaaten der Währungsunion an die Regeln halten müssen; keine Frage. Aber zur finanziellen Stabilität des Euroraums gehören ganz sicher auch die Harmonisierung von Steuerbemessungsgrundlagen und eine weitgehende Harmonisierung der Körperschaftsteuer. Dazu gehört übrigens auch, dass wir nicht immer nur sehr klar wissen, wie finanzielle Solidität organisiert wird, sondern endlich genauso klar wissen, dass wir die zweite Säule brauchen. Wir brauchen Klarheit darüber, wie Wachstum und Beschäftigung sowie Arbeit und Innovation in Europa finanziert werden.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Daran mangelt es in Europa.
Meine Damen und Herren, für Deutschlands Stärke im kommenden Jahrzehnt gibt es, glaube ich, wichtige Grundwerte in unserer Republik. Wir dürfen uns nicht abschotten oder abkehren von der internationalen Entwicklung, nicht von Europa und nicht vom Nahen Osten oder von Afrika. Das Signal, dass Deutschland Flüchtlinge nicht abweist, sondern aufnimmt, ist übrigens ein Zeichen der Stärke, das unsere Partner in der Welt gut verstehen. Jedenfalls international wird es klar verstanden.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Natürlich müssen wir Fluchtursachen bekämpfen. Wir müssen für Stabilität sorgen.
Gestern ist in der Debatte zu Recht, ich glaube, von Frau Göring-Eckardt, auf die Rüstungsexportthemen hingewiesen worden. Sie hat gesagt: Das dürft ihr nicht machen. – Sie hat, glaube ich, zu mir gesagt, dass sie mich am Handeln messen möchte. Deswegen habe ich mir vorgenommen, heute dazu zumindest ein paar Bemerkungen zu machen.
(Volker Kauder [CDU/CSU]: Jetzt ist sie nicht da! Schade!)
– Da gibt es welche, die ihr das sicher erzählen werden.
(Heiterkeit bei der SPD – Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Gut, dass Sie jetzt was sagen!)
Wenn ich fertig bin, könnte es sein, dass sie es ihr lieber nicht erzählen.
Der Gesamtwert der Rüstungsexporte, Herr Krischer, ist 2014 um 1,8 Milliarden Euro gesunken. Das sagt aber eigentlich gar nichts über die Qualität von Rüstungsexporten aus.
(Volker Kauder [CDU/CSU]: Genau!)
Es können kleine Summen sein, weil Kleinwaffen preiswert sind. Sie sind aber viel gefährlicher als vielleicht ein teures, großes Schiff.
Wir haben die Verkaufszahlen von Kleinwaffen, Herr Krischer, halbiert, und wir haben den Rüstungsexport in Entwicklungsländer ebenfalls halbiert. Die Top Vier bei Kleinwaffen sind heute: NATO, EU, NATO-gleichgestellte Länder. 2015 haben wir in Deutschland den Kleinwaffenexport so stark reduziert, dass für das erste Halbjahr der geringste Wert seit 15 Jahren ausgewiesen wird. Ehrlich gesagt, ich lasse mich bei dieser Bilanz gern an meinem Handeln messen. Ich finde, das kann noch besser werden, aber so schlecht wie in der Vergangenheit ist es in Deutschland Gott sei Dank nicht mehr.
(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Josef Göppel [CDU/CSU])
Die Große Koalition ist weit restriktiver als alle Vorgängerregierungen, deren Genehmigungen übrigens noch immer zum Teil die Ausfuhrstatistik prägen. Ich gebe zu, dass ich mich darüber ärgere, dass ich immer noch Ausfuhrgenehmigungen mittragen muss, die von Vorgängerregierungen erteilt wurden. Die Bilanz wäre noch besser, wenn ich das nicht müsste. Allerdings finde ich es besonders ärgerlich, wenn ausgerechnet Kollegen von den Grünen mich dafür kritisieren; denn ich habe jedenfalls keine Lizenzen erteilt, Fabriken für deutsche Gewehre in Spannungsgebieten zu errichten. Im Gegenteil: Wir haben in der Bundesregierung mit unseren Kleinwaffengrundsätzen gerade beschlossen, dass es solche Lizenzfertigungen in Zukunft gar nicht mehr geben wird. Wir haben Schluss gemacht mit dem Liefern und Vergessen. Wir verschärfen die Endverbleibskontrolle vor Ort, und wir haben keine Kampfpanzer für Regionen genehmigt, in denen Krieg herrscht und aus denen die Leute fliehen. Vorgängerregierungen haben das getan.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, schlimm genug, dass es auch eine rot-grüne Regierung gewesen ist, die das gemacht hat. Ich finde es nur nicht ganz fair, wenn ausgerechnet ich für die Politik kritisiert werde, die wir gemeinsam mit Ihnen – ich nicht; ich war nicht dabei, aber ein paar von Ihnen
(Volker Kauder [CDU/CSU]: Joschka!)
damals gemacht haben. Deswegen würde ich doch herzlich darum bitten, dass wir in der Debatte anständig und fair miteinander umgehen.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Statt Waffen brauchen wir einen neuen Nord-Süd-Dialog. Das fängt damit an, mehr Mittel für internationale Hilfsorganisationen zur Verfügung zu stellen. Es ist ja eine Schande, wie die derzeitige Lage in Syrien ist. Das UN-Flüchtlingshilfswerk verzeichnet für Syrien eine Finanzierungslücke von 200 Millionen Euro. 65 Prozent der notwendigen Kosten sind nicht gedeckt. Dem regionalen Hilfsprogramm für syrische Flüchtlinge im Nahen Osten fehlen 800 Millionen Euro – eine Unterfinanzierung von 60 Prozent. Das Welternährungsprogramm für Syrien ist ebenfalls zu 60 Prozent unterfinanziert. Das ist, finde ich, eine große Schande für die internationale Staatengemeinschaft.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Herr Minister, darf ich Sie nur darauf aufmerksam machen, dass Sie fröhlich die Redezeit Ihrer Fraktion verbrauchen?
(Volker Kauder [CDU/CSU]: Das macht nichts! – Gegenruf des Abg. Thomas Jurk [SPD]: Das macht schon was!)
Ich habe damit überhaupt kein Problem, möchte nur vermeiden, dass Sie ein Problem mit Ihrer eigenen Fraktion bekommen.
(Heiterkeit – Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das hat er eh schon! – Hubertus Heil (Peine) [SPD]: Wir nehmen es auch von der CDU!)
Herr Präsident, ich würde sagen: Solange die noch klatschen, geht es.
(Heiterkeit – Beifall bei der SPD)
Dann wollen wir einmal abwarten, wie lange das anhält.
Wenn es das einzige Problem bleibt, dann ist doch alles gut.
(Volker Kauder [CDU/CSU]: Richtig!)
Ich will der Ermahnung gerne nachkommen.
Zwei abschließende Bemerkungen.
Ich glaube, dass wir neben der Hilfe in den Herkunftsländern und den Nachbarstaaten dringend einen legalen Zugang nach Europa und nach Deutschland brauchen. Wir brauchen eine Alternative zu Schlepperbanden und zu Menschenhändlern. Solange Menschen keine andere Chance sehen, als über Schlepper und Menschenhändler nach Europa zu kommen, werden wir das Elend an unseren Grenzen nicht los. Migration lässt sich nicht verbieten oder verhindern. Die Migration, wie wir sie jetzt haben, wird stattfinden, auch auf lange Zeit. Was wir brauchen, sind Wege geordneter Migration. Deswegen rate ich uns dringend, in Deutschland das Thema Einwanderungsgesetz voranzutreiben und übrigens auch in Europa für eine solche Politik zu werben.
(Beifall bei der SPD)
Ich fand die gestrigen Worte des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker bewegend und bin froh, dass wenigstens ein erster Schritt getan wurde. Aber ich finde, angesichts der Zahlen, die jetzt in Rede stehen, muss man auch realistisch bleiben. Wenn Jean-Claude Juncker 160 000 Flüchtlinge, die sich derzeit in Italien und Griechenland aufhalten, auf die europäischen Mitgliedstaaten gerecht verteilen will und Deutschland noch einmal 31 000 davon aufnehmen soll, also 20 Prozent, dann muss man die Zahlen ein bisschen einordnen: Deutschland hat bis vorgestern den Zugang von 450 000 Flüchtlingen registriert. Allein im August waren es 105 000, und in den ersten acht Tagen des September waren es bereits 37 000. Vielleicht werden es im September mehr als 100 000. Das zeigt, ehrlich gesagt, dass die Umverteilung von 160 000 Flüchtlingen in Europa ein erster Schritt ist, wenn man es freundlich bezeichnen will. Man kann auch sagen: ein Tropfen auf den heißen Stein.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der CDU/CSU)
Damit darf nicht alles erledigt sein. Wenn wir Europa erhalten wollen, haben wir viel zu tun. Aber vor allen Dingen muss Europa zeigen, dass es seine humane Orientierung beibehält. Wir sind hier in Europa keine Zugewinngemeinschaft, bei der man mitmacht, wenn man Geld kriegt, sondern eine Verantwortungsgemeinschaft. Juncker hat den ersten Schritt getan; die Mitgliedstaaten Europas müssen deutlich mehr Schritte tun.
Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Für die Fraktion Die Linke hat nun der Kollege Roland Claus das Wort.
(Beifall bei der LINKEN)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/5761291 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 121 |
| Tagesordnungspunkt | Wirtschaft und Energie |