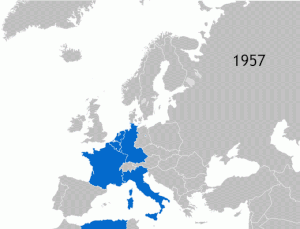Bernd FabritiusCDU/CSU - Berichte zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! In der Zeit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, der immer größeren europäischen Familie und der immer tiefer werdenden Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union – untereinander und mit den Nachbarschaftsstaaten in Partnerschaft – wähnten wir uns in einer Epoche des Friedens in Europa. War dieser Blick womöglich zu sehr nach innen gekehrt? Haben wir nicht bemerkt, dass um uns herum Konflikte schwelten, und darauf etwa zu spät reagiert? Diese Interpretation favorisieren die Gegner Europas, und ich halte sie entschieden für falsch. Wir sollten nicht der Versuchung erliegen, mit zu einfachen Antworten all jenes infrage zu stellen, was – aktuellen Schwierigkeiten zum Trotz – eines der größten friedenspolitischen Projekte der Geschichte ist.
Um dieses wieder in gutes Fahrwasser zu bringen und weiterzuführen, sind konstruktive Lösungen gefragt. Die Diplomatie kennt viele Instrumente, mit denen die aktuellen Konflikte in der Welt gelöst werden könnten. Ein solches Instrument ist mit Sicherheit auch die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik.
Der vorliegende 18. Bericht der Bundesregierung zur AKBP beschreibt, wie dieses Instrument in den Jahren 2013 und 2014 angewendet worden ist. Seither hat sich die weltpolitische Lage deutlich verändert. Der Bericht sollte daher vorausschauend auch als Anleitung zur Lösung aktueller Krisen gelesen werden. Denn: Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik wirkt präventiv und kann verhindern, dass Konflikte überhaupt erst entstehen. Sie wirkt krisenbegleitend zur Linderung der Konfliktauswirkungen und leistet Pionierarbeit im Vorfeld der klassischen Diplomatie.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Zudem ist sie Nachbereiterin sowohl nach Erfolgen als auch dann, wenn Herausforderungen nicht ganz so überzeugend gelöst werden konnten. Die jüngsten diplomatischen Erfolge in den Atomverhandlungen mit dem Iran könnten ein gutes Beispiel für einen unterstützenden Beitrag der AKBP zu den Bemühungen des Bundesaußenministers sein. Im Jahr 2010, als der UN-Sicherheitsrat letztmalig und drastisch die Sanktionen gegen den Iran verschärfte, reiste eine Delegation des Unterausschusses Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik gerade in den Iran und signalisierte so der damaligen iranischen Regierung: Trotz des notwendigen internationalen Drucks bleibt die Tür für Gespräche geöffnet. Die von Ihnen, Frau Kollegin Roth, genannten Einschränkungen betrafen wenige und konkrete Ausnahmen, etwa technische Studiengänge.
Dasselbe Prinzip gilt auch für den Umgang mit Russland im Hinblick auf die Ukraine-Krise. Von den Sanktionen, die wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim verhängt wurden, sind die Mittel der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik explizit ausgenommen worden. Häufig fiel damals der Satz: Man müsse trotz der Differenzen weiter mit Russland sprechen. – Das war selbstverständlich zutreffend, und damit war auch die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik gemeint.
Sosehr ich von der AKBP als Krisenbegleiterin und Wegbereiterin bei der Lösung von Konflikten überzeugt bin, so muss ich zugleich auch Grenzen erkennen. Zur Lösung des Syrien-Konflikts kann die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik derzeit leider wenig beitragen. Von der Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees im Juni in Bonn unter der Leitung von Staatsministerin Böhmer ist aber ein deutliches Signal für einen besseren Schutz der Welterbestätten vor der Zerstörungswut des sogenannten „Islamischen Staates“ ausgegangen.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Wir unterstützen Sie, Frau Staatsministerin, in Ihrem Engagement zum Schutz des Kulturerbes ebenso wie bei Ihrem Vorhaben einer strukturellen Reform des Welterbekomitees.
Mindestens genauso wichtig wie der Schutz des Welterbes ist der Schutz der Menschen vor Krieg und Terror. Hier kann die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zumindest die Not der Menschen lindern, die durch Flucht und Vertreibung Opfer derartiger Ereignisse geworden sind. Ein Ansatz: Durch AKBP kann dazu beigetragen werden, dass in den Zufluchtsregionen dieser Welt, in den Lagern, aus denen es zur Sekundärmigration kommt, die Situation erträglicher wird und Menschen, die bereits gerettet sind, sich nicht erneut auf Wanderschaft begeben müssen. Es muss die allererste Pflicht der gesamten Staatengemeinschaft sein, die notwendigsten Bedürfnisse der Menschen in den Flüchtlingslagern – etwa in Jordanien, der Türkei und im Libanon – zu decken, ausreichend Nahrung, Schlafplätze und ärztliche Versorgung zu sichern. Gleich danach, meine Damen und Herren, sind es aber auch die kulturellen und pädagogischen Angebote, die für die oftmals traumatisierten Menschen eine deutliche Hilfe sind.
Sie erleichtern den tristen Alltag und helfen, Traumata zu überwinden. Lebhaft in Erinnerung bleiben später, wenn Negatives aus dem Gedächtnis verschwindet, gerade die kulturellen Angebote. Hier können wir mit relativ wenig Einsatz viel bewirken. Sie, Frau Kollegin Roth, haben das zu Recht deutlich angesprochen.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD und des Abg. Dr. Harald Terpe [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Sicherlich wird es neben der dringlichen Aufbau- und Entwicklungshilfe gerade auch die AKBP sein, die als eine der Ersten wieder nach Syrien zurückkehren wird, wenn dieser grausame Konflikt beendet ist. Noch mehr kann Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik bewirken, wenn sie präventiv ansetzt und dazu beiträgt, dass Konflikte erst gar nicht entstehen.
Wenn im Zuge der Flüchtlingskrise in den vergangenen Wochen häufig die Rede davon war, dass die Fluchtursachen bekämpft werden müssen, dann ist damit zumindest begleitend auch die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik gemeint. Am Beginn eines friedlichen Miteinanders von Kulturen, von Religionen und von Nationen steht das gegenseitige Verständnis. Ein solches Verständnis kann nicht verordnet werden. Es entsteht langsam und muss im gegenseitigen Dialog auf Augenhöhe erarbeitet werden.
Hier setzt der Schwerpunkt „Kooperation und Dialog“ der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik an. Jeder Euro, den wir in die Prävention von Konflikten investieren, ist gut angelegtes Geld.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD)
Je früher dieses Prinzip in den Bildungsbiografien einer Gesellschaft ansetzt, desto besser. Deshalb fördert die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik den Kinder- und Jugendaustausch gerade auch durch Begegnungen an historischen Gedenkorten. Sie fördert darüber hinaus über verschiedenste Stipendienprogramme unter anderem Schüler, Studierende, Wissenschaftler und Künstler. Diese Investition in das kulturelle Verständnis und die Toleranz der kommenden Generationen ist eine Investition in eine friedliche Zukunft.
Damit komme ich zum wichtigsten Kapital, das die deutsche Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zu bieten hat. Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mittlerorganisationen, Entsandte, Lektoren, Redakteure, Kulturmanager, Lehrer und andere. Sie, meine Damen und Herren, setzen Tag für Tag das um, was die Ausschüsse, der Bundestag, das Auswärtige Amt und die anderen beteiligten Ministerien beschließen. Dafür sage ich an dieser Stelle deutlich: Danke schön.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Eine Gruppe möchte ich besonders hervorheben, nämlich unsere Auslandslehrkräfte. Das deutsche Auslandsschulwesen ist ein Flaggschiff der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, was auch in dem vorliegenden Bericht klar seinen Niederschlag findet. Die deutschen Auslandslehrkräfte vermitteln unsere Werte in Regionen der Welt, in denen oftmals ein Mangel an Chancengleichheit und Demokratie herrscht. Sie leisten damit wertvolle Arbeit als Bildungs- und Wertebotschafter der Bundesrepublik Deutschland.
Sie vermitteln und fördern als primäre Aufgabe die deutsche Sprache im Ausland. Die Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache schafft eine nachhaltige Bindung an Deutschland bei denen, die dann auch unsere Sprache sprechen. Mindestens ebenso wichtig ist nach meiner Überzeugung die Vermittlung von Deutsch als Muttersprache dort, wo eine entsprechende Nachfrage besteht. Muttersprachlicher Unterricht ist für im Ausland lebende Deutsche und deren Kinder existenziell wichtig. Die Sprache ist Teil ihrer Persönlichkeit und Identität. Ohne entsprechende Angebote wären gerade diese in allen Gebieten im Ausland, in denen deutsche Gemeinschaften leben, erheblich gefährdet.
Ich komme zurück auf die entsandten deutschen Lehrer. Seit bald 15 Jahren sind deren Bezüge von der Lohnentwicklung abgekoppelt. Der Unterausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist sich in weiten Teilen darüber einig, dass sich die Probleme bei der Personalfindung für die deutschen Auslandsschulen erheblich verschärfen werden, wenn wir nicht bereits im nächsten Haushalt deutlich gegensteuern.
(Beifall bei der CDU/CSU und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg. Siegmund Ehrmann [SPD])
Ich komme zum Ende. – Mir ist natürlich klar, dass wir schon wegen der aktuellen Flüchtlingskrise vor großen Herausforderungen stehen. Trotzdem und gerade wegen der vorher dargelegten Bedeutung und Wirkungsweise der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik wäre ein nachlassendes Engagement auf diesem Gebiet fatal. Ich werbe daher eindringlich um die Unterstützung des gesamten Bundestages für diesen Bereich.
Danke.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie der Abg. Claudia Roth (Augsburg) [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Die Kollegin Doris Barnett hat für die SPD-Fraktion das Wort.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/5897006 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 128 |
| Tagesordnungspunkt | Berichte zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik |