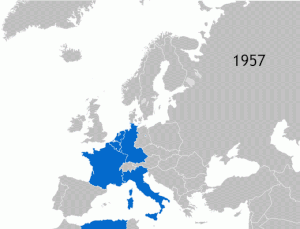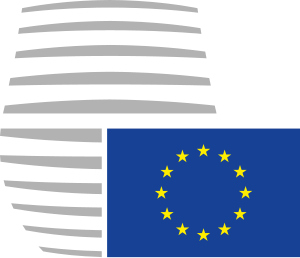Thomas DörflingerCDU/CSU - Gemeinsame europäische Grundwerte
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will mir zu Beginn meiner Rede die Kritik meines Sohnes an meinem jüngsten Plenarbeitrag zu eigen machen, den ich um eine ehrliche Einschätzung gebeten hatte. Er hat gesagt: War prima; aber verstanden habe ich leider nichts. – Offenkundig ist das der Beweis dafür, dass wir, wenn wir es ohnehin schon mit schwierigen Dingen zu tun haben, eine besondere Begabung dafür haben, diese schwierigen Dinge auch noch schwierig zu erklären.
Deswegen beginne ich mit den Anfängen: Als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft – so hieß die Vorgängerorganisation der heutigen EU damals – Mitte der 1950er-Jahre gegründet wurde, hat man sich darauf verständigt, dass sich diejenigen, die damals schon dabei waren, und diejenigen, die dazukommen möchten, an bestimmte Grundwerte halten. Das sind im Wesentlichen, um es zu vereinfachen, die Dinge, die wir aus dem Grundgesetz unseres Landes kennen: Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Achtung vor der Menschenwürde, Achtung der Menschenrechte und alle weiteren dort niedergelegten Grundrechte. Das steht so auch in der Nachnachnachfolgeversion der Römischen Verträge, im Lissabon-Vertrag, im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
Die Frage, vor der wir nun stehen, heißt: Was tun wir, wenn sich ein Mitgliedstaat der Europäischen Union in der politischen Praxis erkennbar nicht an diesen Grundwerten orientiert oder sogar dagegen verstößt? Ich verweise auf Artikel 7 des Lissabon-Vertrages, der bestimmte Pönale, also bestimmte Strafen, vorsieht; diese Strafen sind sehr drakonisch. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit des Entzugs des Stimmrechtes. Das heißt, das jeweilige Land kann im Rat, also in der Runde der europäischen Staats- und Regierungschefs, seine Stimme nicht mehr mitabgeben. Daraus folgt: Wenn die Strafe so drakonisch ist, dann zieht sie notwendigerweise nur dann, wenn auch der Verstoß sehr bedeutend war.
Um ein Beispiel zu nennen: Wenn ein Land die Pressefreiheit abschaffen würde, dann würde Artikel 7 des Lissabon-Vertrages vermutlich greifen. Aber wenn ein Land an der Pressefreiheit nur kratzt oder sie einschränkt, dann ist dieser Artikel 7 vermutlich ein Schwert, das zu scharf ist, weil die Strafe zu hoch ist. Daher stellt sich die Frage: Haben wir ein Format, um derartige Verstöße zu ahnden oder um mit dem jeweiligen Land ins Gespräch zu kommen? Das ist in Artikel 7 so nicht verankert; dieses Format gibt es so nicht. Das hat den deutschen Außenminister – seinerzeit Guido Westerwelle – im Jahr 2013 zusammen mit seinen Amtskollegen aus Dänemark, den Niederlanden und Finnland auf die Idee gebracht, die sogenannte europäische Rechtsstaatsinitiative auf den Weg zu bringen. Diese sieht ein Verfahren unterhalb des relativ komplizierten Verfahrens in Artikel 7 vor, bildlich gesprochen: ein Format, in dem man zunächst einmal miteinander spricht und versucht, die Dinge in einem Dialog, in einem Trilog zu klären. Wenn jemand in der eigenen Familie über die Stränge schlägt, dann verweist man ihn auch nicht gleich des Hauses, sondern man setzt sich zunächst an einen Tisch und versucht, die Dinge in einem ruhigen, sachlichen Ton miteinander zu klären. – So weit, so gut.
Der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, der heute auf dem Tisch liegt, geht aber über das, was die europäische Rechtsstaatsinitiative vorsieht, bei weitem hinaus und ist auch der Grund dafür, weswegen sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit dem Inhalt in keiner Weise anfreunden kann. Bei der Konstruktion der europäischen Rechtsstaatsinitiative wurde sehr bewusst darauf geachtet, dass eben nicht eine neue Institution geschaffen wird, sondern dass man mit den vorhandenen Mitteln, die das Instrumentarium innerhalb der Europäischen Union bietet, das Format abbildet, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Wenn ich in dem Antrag nun etwas von Monitoring Panels und unabhängigen Expertenrunden lese, dann mag das in Ihrer politischen Intention folgerichtig sein.
(Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ja!)
– Das habe ich erwartet, Herr Kollege Sarrazin. Aber ich bitte gleichzeitig um Verständnis, dass wir diesem Ansatz so nicht folgen.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Wir verfolgen den Ansatz auch deswegen nicht – das fand ich in dem Antrag der Grünen besonders spannend –: Wir sind uns vermutlich einig darüber, dass alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union – wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung – Rechtsstaaten sind. In Rechtsstaaten gibt es ein Selbstreinigungsverfahren, das jeder Demokratie eigen ist. Das kommt aber im Antrag der Grünen nicht einmal im Wort vor, was mich wundert. Ich weiß nicht, wer das Wort „Basisdemokratie“ schlussendlich erfunden hat, aber wenn es um die Urheberrechte geht, könnte es sein, dass die Grünen in die engere Auswahl kommen. Auch das Wort „Wahl“ kommt in dem Antrag gar nicht vor. Die Wahl ist im demokratischen Rechtsstaat ein Selbstreinigungsmittel, das die Bürgerinnen und Bürger selbst zur Anwendung bringen, indem sie schlicht und ergreifend die Regierung, die sie möglicherweise in ihren Rechten beschneidet oder einschränkt, abwählen, ohne dass es dazu von außen eines Hinweises bedurft hätte.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Das liegt in der Zuständigkeit jedes einzelnen Nationalstaats.
Ich finde es interessant, dass zu den Handlungsempfehlungen, zu den Vorstellungen, die die Europäische Kommission entwickelt hat, im März des vergangenen Jahres, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Gutachten des Juristischen Dienstes des Europäischen Rates herausgegeben wurde. Die Kommission hatte vorgeschlagen, ein mehrstufiges Verfahren zu etablieren, um die europäische Rechtsstaatsinitiative formal abzubilden. Kernsatz der Einschätzung des Juristischen Dienstes des Rates ist, dass die Vorschläge nicht durch die Zuständigkeit der Europäischen Union gedeckt sind.
Dann finde ich es hochinteressant, dass Sie nicht nur auf der Basis dieses Gutachtens einen Antrag formulieren, der das abbildet, was schon durch den Juristischen Dienst des Rates als rechtswidrig eingestuft worden ist, sondern dass Sie noch einen obendrauf setzen und offenkundig glauben, die Rechtswidrigkeit wäre geringer als bei der Vorlage, auf die Sie sich bezogen haben. Das erschließt sich mir logisch nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Wir bleiben dabei – insofern teile ich das, was Staatsminister Roth zu Beginn der Debatte gesagt hat –: Der Anlass und der Kern der europäischen Rechtsstaatsinitiative, so wie sie durch Guido Westerwelle und seine Amtskollegen 2013 auf den Weg gebracht worden ist, finden unsere Zustimmung, weil es ein Format unterhalb von Artikel 7 ist, in dem Verstöße gegen die europäischen Grundrechte in den Nationalstaaten besprochen werden können.
Aber Institutionen neu ins Leben zu rufen, die das Ziel verfolgen, durch ein auch parlamentarisch nicht legitimiertes Gremium,
(Andrej Hunko [DIE LINKE]: Sehr richtig!)
das von irgendwem besetzt wird,
(Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Vom Parlament!)
einen Mechanismus zu installieren, der dazu da ist, bestimmte Fehlentwicklungen – tatsächliche oder vermeintliche – in den einzelnen Mitgliedstaaten zu ahnden oder zu korrigieren, das halte ich nicht nur für nicht vereinbar mit europäischem Recht, das halte ich auch politisch für nicht angezeigt, meine sehr verehrten Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Deswegen bleiben wir dabei: Wenn die luxemburgische Ratspräsidentschaft im Verlauf dieses Jahres einen Vorschlag vorlegt – der Staatsminister hatte darauf hingewiesen –, wie in der europäischen Rechtsstaatsinitiative in diesem Jahre und in den Folgejahren zu verfahren ist, dann ist das für uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Basis, auf der wir in den kommenden Jahren weiterarbeiten. Dafür brauchen wir weder neue Gremien noch neue Institutionen. Wir arbeiten mit dem, was wir haben.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Vielen Dank, Kollege Dörflinger. – Nächste Rednerin in der Debatte: Dr. Franziska Brantner für Bündnis 90/Die Grünen.
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/5975719 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 130 |
| Tagesordnungspunkt | Gemeinsame europäische Grundwerte |