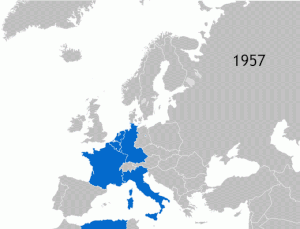Heiko Maas - Einführung einer Speicherfrist und Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf geben wir Justiz und Polizei bei schwersten Straftaten ein zusätzliches Instrument an die Hand. Wir geben es ihnen an die Hand, um dabei mitzuhelfen, dass Straftaten wie Mord und Totschlag sowie Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung besser aufgeklärt und damit weitere Straftaten der betreffenden Straftäter verhindert werden können.
Wir wägen die Rechtsgüter untereinander ab: Es ist ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Aber in der Abwägung der Rechtsgüter kommen wir zu dem Ergebnis, auch nach höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass dieser Eingriff nicht nur verhältnismäßig, sondern auch zulässig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU – Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Aber nicht erforderlich! – Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Und notwendig!)
Er ist auch verhältnismäßig, weil nun im Vergleich zur früheren Vorratsdatenspeicherung weniger Daten gespeichert werden, weil sehr viel kürzer gespeichert wird und weil der Zugriff auf die Daten deutlich erschwert worden ist. Nicht gespeichert wird der Inhalt von Telefongesprächen, welche Internetseiten aufgerufen werden. Und jetzt werden auch sämtliche E-Mails ausgenommen; es wird nicht gespeichert, wann eine E-Mail gesendet oder empfangen worden ist.
(Thomas Strobl (Heilbronn) [CDU/CSU]: Schönheitsfehler!)
Außerdem werden die Standortdaten nur noch für vier Wochen erfasst, alle übrigen Daten zehn Wochen. Danach müssen sie gelöscht werden. Damit werden wir der höchstrichterlichen Rechtsprechung vollumfänglich gerecht.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Meine Damen und Herren, schließlich haben wir auch den Katalog der Straftaten, bei deren Verfolgung die Daten genutzt werden dürfen, stark eingeschränkt; die Anzahl der entsprechenden Delikte haben wir halbiert.
(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Och! Das ist ja ein wichtiges Argument!)
– Das kann man ganz einfach nachzählen, Frau Künast.
(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist mir aber zu wenig!)
Ich möchte insbesondere auf drei Aspekte eingehen, die in der Beratung eine besondere Rolle gespielt haben.
Der erste Aspekt ist die schon angesprochene Stellungnahme der Europäischen Kommission. Ich bin ein bisschen verwundert, dass die Europäische Kommission in der Lage ist, sich so intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen,
(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das muss sie ja! Dafür wird sie ja bezahlt! Notifizierung! Das muss sie jetzt! Während Sie vergessen haben, dass man notifizieren muss!)
aber sich anscheinend dennoch nicht in der Lage sieht, eine neue Richtlinie auf den Weg zu bringen, um die Dinge in Europa vielleicht etwas einheitlicher zu regeln. Nichtsdestotrotz: Die Kommission hat kritisiert, dass wir in dem Gesetzentwurf vorsehen, dass die erhobenen Daten ausschließlich in Deutschland gespeichert werden dürfen. Die Kommission meint, es müsse eben auch zulässig sein – und zwar aus Wettbewerbsgründen; es hat nichts mit Datenschutz zu tun, sondern bedeutet, wie wir finden, genau das Gegenteil –, die Daten in anderen Mitgliedstaaten der EU zu speichern.
Meine Damen und Herren, es ist sicherlich nicht so, dass es nur in Deutschland einen Datenschutz gibt. Aber der Europäische Gerichtshof hat erst vor wenigen Tagen das Safe-Harbor-Abkommen für ungültig erklärt und hat sehr deutlich gezeigt, dass Brüssel mit dem Datenschutz bisher vielleicht doch etwas zu leichtfertig umgegangen ist.
Deshalb bleibt es für uns dabei: Deutsche Daten sind ausreichend und gut geschützt, aber das können wir im Zusammenhang mit den Höchstspeicherfristen nur gewährleisten, wenn die Daten weiterhin in Deutschland gespeichert werden.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Wenn die Daten auf Servern im Ausland liegen, können wir nicht rechtssicher nachvollziehen, ob sie dort von Behörden, Polizei und Diensten abgegriffen werden. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, den Gesetzentwurf an dieser Stelle trotz der Einwendung der Kommission nicht zu verändern.
Der zweite Punkt ist hier auch schon angesprochen worden, nämlich der Schutz des Berufsgeheimnisses. Für Personen und Institutionen, die anonyme Hilfe und Beratung anbieten, stellen wir sicher, dass Verbindungsdaten zu ihren Anschlüssen überhaupt nicht gespeichert werden; das betrifft die Telefonseelsorge oder ähnliche Einrichtungen. Wichtig ist aber, noch einmal klarzustellen: Viele andere Berufsgruppen, bei denen es auch ein Berufsgeheimnis zu wahren gilt, arbeiten nicht anonym: Rechtsanwälte arbeiten nicht anonym, sie können auch gar nicht anonym arbeiten. Das Berufsgeheimnis will hier nicht die Anonymität schützen, sondern ein besonderes Vertrauensverhältnis zum Mandanten oder – bei Ärzten – zum Patienten.
(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Und dass es ein Mandat gibt! Das muss man auch schützen!)
Deshalb schreiben wir ins Gesetz, dass für alle Berufsgeheimnisträger ein umfassendes Erhebungs- und Verwertungsverbot, also auf der Zugriffsebene, gilt. Solche Verbote kennt das Gesetz auch schon heute, zum Beispiel bei so gravierenden Eingriffen wie der akustischen Wohnraumüberwachung. Auch dort bietet das Erhebungs- und Verwertungsverbot umfassenden Schutz – das wurde bisher auch nicht kritisiert –, und genau diesen Schutz wird es zukünftig auch bei den Verkehrsdaten geben. Das ist in unserem Gesetz so gesichert.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU – Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das habe ich doch gerade vorgelesen: Es darf nicht gespeichert werden!)
Der dritte Aspekt betrifft den neuen Straftatbestand der Datenhehlerei; darüber ist in den letzten Wochen einiges geschrieben worden. Wenn wir einerseits den Pool gespeicherter Daten erweitern, dann müssen wir andererseits diese Daten in Zukunft wirksamer schützen. Das sind wir nicht nur den Betroffenen schuldig, sondern das ist eine Erkenntnis aus der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft, an der wir uns nicht vorbeimogeln können.
Der Vorwurf, damit würden auch Whistleblower kriminalisiert, trifft nicht nur nicht zu: Er ist völlig falsch und an den Haaren herbeigezogen. Datenhehlerei gilt nur für gestohlene Daten, die zum Beispiel durch einen Hackerangriff erbeutet werden. Ein Whistleblower besitzt aber in der Regel seine Informationen völlig rechtmäßig. Der entscheidende Punkt bei ihm ist die Weitergabe der Information, aber diese Weitergabe ist weder für den Whistleblower eine Datenhehlerei noch für denjenigen, der die Information entgegennimmt; das ist eigentlich relativ einfach nachvollziehbar.
Wir stellen außerdem sicher, dass Journalisten durch den neuen Straftatbestand nicht beeinträchtigt werden. Ihre Tätigkeit wird von diesem Straftatbestand nicht erfasst; das schreiben wir sogar explizit ins Gesetz.
(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Aber nur in die Begründung!)
Dabei ist es nicht erforderlich, dass der Journalist schon bei der Beschaffung der Daten eine konkrete Veröffentlichung vor Augen oder einen Artikel in der Schublade hat. Geschützt werden zwar nicht die rein privaten Aktivitäten eines Journalisten, aber es reicht, wenn die Handlungen der Recherche dienen und in eine Veröffentlichung münden können. Insofern ist vieles, was in den letzten Wochen zu diesem Thema gesagt und veröffentlicht wurde, einfach völlig falsch. Ich bitte, das zu berücksichtigen.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Damit diese Bestimmung wirkt, gilt der Tatbestandsausschluss nicht nur für hauptberufliche Journalisten, sondern er schützt auch freie Mitarbeiter und nebenberufliche Journalisten, und auch Blogger können sich grundsätzlich darauf berufen. Das heißt, es gibt an der Stelle keine Schutzlücke.
Meine Damen und Herren, der Bundestag hat im Rahmen seiner Beratungen den Gesetzentwurf an einer wichtigen Stelle ergänzt: Er hat eine verbindliche Evaluierung vorgesehen. Ich glaube, dass das eine sehr vernünftige Ergänzung ist, weil darüber diskutiert wird, was die Speicherung von Daten überhaupt nutzt. Nach der Evaluierung, wenn die Daten ausgewertet sind, wissen wir, welche Kosten dabei anfallen und wie diese Daten den Ermittlern helfen. Wenn das Ergebnis der Evaluierung vorliegt, werden wir darüber eine Debatte führen können, und zwar auf einer vernünftigen, empirischen Grundlage, die es bisher noch nicht gibt.
Ich danke den Abgeordneten des Bundestages für diese Ergänzung, auch für die sicherlich nicht immer einfachen Beratungen. In diesen Dank will ich auch die Mitarbeiter meines Hauses einschließen, denen wir in diesem Verfahren einiges an Arbeit abverlangt haben.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem Abgeordneten Konstantin von Notz, Bündnis 90/Die Grünen.
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/5978311 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 131 |
| Tagesordnungspunkt | Einführung einer Speicherfrist und Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten |