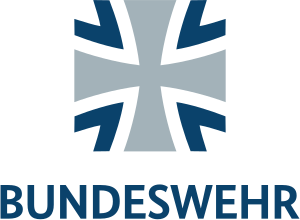Florian HahnCDU/CSU - Vereinbarte Debatte: 60 Jahre Bundeswehr
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 30. Oktober 1995 sprach der damalige bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber anlässlich des feierlichen Gelöbnisses von Rekruten aus ganz Bayern, das gleichzeitig die bayerische Feier zum 40-jährigen Bestehen der Bundeswehr in Bayern darstellte:
Ohne die Bundeswehr, ohne eigenen Verteidigungsbeitrag wäre die Bundesrepublik Deutschland nicht zu dem geworden, was sie heute ist: ein wiedervereinigtes, freies und im Verhältnis zu den übrigen Staaten der Erde wohlhabendes Land, ein geachtetes Mitglied der Völkergemeinschaft. Ich will gerade im Jahr 1995 darauf aufmerksam machen, dass vor 50 Jahren Deutschland ein geächtetes Land war. Dass wir in fünf Jahrzehnten miteinander so viel erarbeiten konnten, verdanken wir unseren Verbündeten, der Einsatzbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land und vor allem auch der Bundeswehr.
Ich war an diesem Abend selbst Rekrut und von der Rede tief bewegt, allerdings auch irgendwie froh, als die ganzen Reden vorbei waren und wir endlich zum Gelöbnis kamen. Schließlich ist es durchaus anstrengend gewesen, über eine Stunde in Reih und Glied angetreten zu sein.
Ministerpräsident Stoiber sagte weiter:
Ihr Gelöbnis findet in einem historisch denkwürdigen Moment statt. Es ist der Geburtstag der Bundeswehr, der ersten freiheitlich-demokratischen Armee Deutschlands, eingebettet in die demokratische Gemeinschaft unserer Partner im transatlantischen Bündnis. Ohne diese Einbettung hätte Deutschland, das Land in der Mitte Europas mit den meisten Nachbarn überhaupt, fünf Jahrzehnte nach der größten Katastrophe, die es für Deutschland und Europa je gegeben hat, nicht den Zustand erreicht, dass wir heute mit all unseren Nachbarn in Frieden und Freundschaft leben. Dafür haben Generationen von Deutschen gekämpft, gebetet, gehofft. Das ist nicht selbstverständlich, auch wenn wir es leider heute als selbstverständlich empfinden.
Ich finde, diese Worte Stoibers haben auch heute noch ihre Berechtigung.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Diskussion über die deutsche Wiederbewaffnung fiel in eine Zeit, in der die Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges noch greifbar waren. Im Deutschen Bundestag diskutierten Abgeordnete über die Aufstellung deutscher Streitkräfte, die keine Abstraktionsfähigkeit benötigten, um sich die ganzen möglichen Konsequenzen, nicht nur den Aufbau von Fähigkeiten, sondern vor allem auch die Bereitschaft, als Ultima Ratio im Bündnis wieder militärisch handlungsfähig zu sein, vorzustellen.
So war die Wiederbewaffnung keineswegs unumstritten. Die CSU war von Beginn an ein überzeugter Befürworter eigener deutscher Streitkräfte. Ein zentrales Argument sprach aus ihrer Sicht dafür: Deutschland sollte seine volle Souveränität wiedererlangen. Der Staat, so jung er auch noch war, brauchte ein Instrument, um seine Bürger vor der sehr realen sowjetischen Aggression zu schützen. Die Integration in ein Verteidigungsbündnis, ohne selbst einen substanziellen Beitrag zur kollektiven Sicherheit zu leisten, wäre nicht tragbar gewesen. Auch die USA forderten mehr Verantwortung von Deutschland.
Weiter war die CSU davon überzeugt, dass Deutschland nur in enger Kooperation mit den europäischen Nachbarn zur Wiederbewaffnung fähig ist. Dem Argwohn der SPD, dass die Wiederbewaffnung Deutschlands die Einheit gefährdet, setzte Franz Josef Strauß in der historischen Debatte von 1952 eine überzeugende Richtungsvorgabe entgegen: über die Einheit Europas zur Wiedervereinigung Deutschlands – ein Weg, der bekanntermaßen 1989 zur deutschen Einheit führte.
Der spätere Verteidigungsminister Strauß, lieber Herr Gehrcke, der mit Fug und Recht als einer der Väter der Bundeswehr bezeichnet wird, fasste die Problematik der Wiederbewaffnung damals treffend zusammen:
Wer ja sagt, muß sich die Verantwortung für die Folgen überlegen. Wer nein sagt, nein um jeden Preis, muß für die Konsequenzen einstehen, die aus dieser Verantwortung erwachsen.
(Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: Bin ich ja!)
Damit nahm er die Abgeordneten, die dem pazifistischen Leitmotiv ein plakatives „Ohne mich“ voranstellten, in die Verantwortung. Er selbst nannte sich später einmal einen „Verantwortungspazifisten“. Um den Frieden zu sichern, so Strauß, müssen notfalls auch militärische Instrumente in Erwägung gezogen werden. Er als Historiker hat dabei vor allem auf die Untätigkeit der europäischen Demokratien in der Sudetenkrise und beim Überfall auf Polen in den 30er-Jahren hingewiesen. Der linke Gesinnungspazifist könne vielleicht besser schlafen; aber durch sein rigoroses Nein zu militärischen Mitteln könne er auch zur Verschärfung der Lage beitragen –
(Max Straubinger [CDU/CSU]: So ist es!)
eine Schlussfolgerung, die auch 60 Jahre nach Gründung der Bundeswehr weiterhin ihren Wahrheitsgehalt hat; gerade die Kollegen der Fraktion Die Linke sollten hier aufhorchen.
(Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf des Abg. Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE])
Die permanente Gefahr aus Moskau beeinflusste das politische Arbeiten in einer Art und Weise, wie wir uns das heute nicht mehr vorstellen können. So musste die Bundeswehr in kürzester Zeit Fähigkeiten aufbauen, um in der Blockkonfrontation handlungsfähig zu sein. Auch umstrittene Entscheidungen fielen unter diese Prämisse, so zum Beispiel die Beschaffung des Starfighters. Für ehemalige Marineflieger wie Harm Zander war der Starfighter ein gutes Flugzeug. Mit ihm konnten deutsche Piloten den Fliegern des Ostblocks waffentechnisch endlich auf Augenhöhe begegnen. Der Supersonic-Jet stellte an die Piloten allerdings auch höchste Anforderungen. Der Erfolg der Wehrhaftigkeit ist heute offenkundig, aber er forderte auch viele Opfer: 116 Piloten verunglückten tödlich bei Flügen mit dem Starfighter. Wir gedenken heute daher auch derer, die für einen Frieden in Freiheit während der Ausübung ihres Dienstes bis heute ihr Leben verloren.
Von Beginn an war klar, dass die Streitkräfte eine neue Führungsphilosophie brauchten, die sich an den Prinzipien des Grundgesetzes orientierte. Das von General Baudissin eingeführte Konzept der Inneren Führung garantierte eine militärische Führung, die soziale und individuelle Aspekte des Menschen berücksichtigte. Soldaten sollten nicht einfach nur funktionieren oder etwa einen Sonderstatus genießen, sondern sich als Staatsbürger in Uniform verstehen. Weltweit beachtet, ist das unter dem Eindruck der Erfahrung aus Krieg und Diktatur entstandene Leitbild noch immer die tragende Säule des militärischen Selbstverständnisses.
Die Bundeswehr bildete aber nicht nur die Brücke nach Westen. Wenige wissen, dass von der noch jungen Armee ein Samen für die besondere deutsch-israelische Freundschaft gesetzt wurde. Schon 1958, drei Jahre nach der Gründung der Bundeswehr, nahmen die Armeen beider Länder die ersten Kontakte auf – 13 Jahre nach dem Holocaust, bei dem sich deutsche Wehrmachtssoldaten mitschuldig gemacht haben.
Obwohl es diplomatische Beziehungen zwischen Israel und Deutschland noch nicht gab, begannen Vertreter der Marine beider Armeen mit der Zusammenarbeit. Die Deutschen halfen Israel beim Aufbau seiner U-Boot-Flotte. Damit stellten sich die Soldaten aktiv unserer aus der Geschichte entstandenen Verantwortung, die Sicherheit und die Existenz Israels zu schützen. Dieses besondere Verhältnis wurde einmal mehr 1990 deutlich, als der Zerstörer „Bayern“ als erstes deutsches Kriegsschiff den israelischen Hafen Haifa besuchte. Mein Bruder, der damals als Obergefreiter Philip Hahn auf der „Bayern“ seinen Wehrdienst absolvierte, erzählte mir damals von dem bewegenden Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem, bei der die Marinesoldaten in Uniform einen Kranz niederlegten.
Auch heute ist der Ruf nach mehr Verantwortung Deutschlands stärker denn je. Nicht nur bei Themen wie der Finanzkrise muss Deutschland als Orientierungsmacht auftreten; auch in der Außenpolitik bedarf es eines Zeichens Deutschlands, um beispielsweise den europäischen Stillstand zu überwinden.
Die aktuellen Herausforderungen zwingen uns, die Rolle des Militärs neu zu bestimmen. Mit der Entscheidung unserer Bundesministerin von der Leyen, ein neues Weißbuch zu verfassen, gehen wir diese Aufgabe entschlossen an.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Soldatenberuf ist kein Beruf wie jeder andere. Ich möchte daher unseren Soldatinnen und Soldaten, die im In- und Ausland aktuell im Einsatz sind oder es waren, meinen persönlichen Respekt, hohe Anerkennung und ein herzliches „Vergelt‘s Gott!“ aussprechen. Ebenso möchte ich den 55 000 zivilen Mitarbeitern und Fachkräften von Herzen danken, ohne die unsere Truppe nicht funktionieren würde. Die Bundeswehr ist und bleibt ein tragender Stützpfeiler unserer freien demokratischen Grundordnung. Wir können auf unsere Bundeswehr zu Recht stolz sein.
Herzlichen Dank.
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/6142458 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 136 |
| Tagesordnungspunkt | Vereinbarte Debatte: 60 Jahre Bundeswehr |