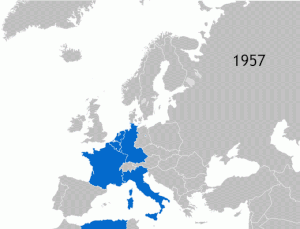Detlef SeifCDU/CSU - Arbeitsprogramm der EU-Kommission 2016
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Das Arbeitsprogramm der EU-Kommission 2016 lässt zunächst einmal das erklärte Ziel von Jean-Claude Juncker, dem Kommissionspräsidenten, ganz klar erkennen: Bürokratieabbau, Verschlankung, Beschränkung auf das Notwendige. Vergleicht man 2010 – da gab es 316 neue Initiativen – mit dem aktuell laufenden Jahr – da gibt es 23 –, dann erkennt man, dass das an dieser Stelle ernst gemeint ist. Man kann darüber streiten, ob die Prioritäten im Einzelnen richtig gesetzt sind. Aber eines steht fest: Egal welche Meinung man vertritt, „Business as usual“ ist nicht der Spruch der Zeit. Insoweit ist diese Überschrift des Arbeitsprogramms – ich glaube, da besteht Einigkeit – richtig gewählt.
Die Kommission benennt dann Themen, die sie als Herausforderungen der Europäischen Union sieht. An erster Stelle steht ganz klar die Flüchtlingskrise, dann die Arbeitslosigkeit nebst Beschäftigungs- und Wachstumslücke, die Notwendigkeit einer Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion, der Klimawandel, die instabile Lage der östlichen und südlichen Partnerschaft, natürlich auch – das ist angesprochen worden – der faire Deal für das Vereinigte Königreich, für Großbritannien. Was ich in dieser Auflistung nicht finde, was aber sicherlich auch eine besondere Herausforderung ist, ist die effektive Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Die gehört für mich ganz klar prioritär nach oben.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Die Flüchtlingskrise – das haben die Beiträge gezeigt – ist aber das Masterthema der Stunde, der Gegenwart: kommunal, regional, national und international. Auch wird diese Krise nur gelöst werden können, wenn wir eine europäische Lösung, europäische Regeln im Kontext mit guten intelligenten nationalen Regelungen und natürlich auch mit internationalen Rahmenbedingungen finden. Eine nie dagewesene Anzahl von Flüchtlingen hat zwischenzeitlich den Weg nach Europa gefunden. Im letzten Jahr – man weiß es nicht genau, weil die Registrierung nicht hundertprozentig genau funktioniert – sind schätzungsweise 1,4 Millionen Menschen hier angekommen. Zurzeit kommen täglich 2 000 bis 3 000 Menschen an.
Die EU-Kommission legte im vergangenen Jahr eine Migrationsagenda vor, und dann folgten auch Legislativvorschläge. Das sah richtig ambitioniert aus. Nach einigen Seiten hat man schon gedacht: Hier ist etwas in Bewegung.
In der jüngsten Sitzung des Gremiums der EU-Kommission am 13. Januar dieses Jahres – da braucht man gar keinen anderen zu zitieren – lautete die ernüchternde Feststellung: Keine dieser vorrangigen Maßnahmen ist auch nur in irgendeiner Hinsicht zureichend umgesetzt worden. Der Kollege Ulrich hat es angesprochen: Es sollten 160 000 Flüchtlinge verteilt werden. Die ganz aktuelle Zahl ist aber immerhin auf 414 gestiegen, und das nach etlichen Monaten. Von den elf Hotspots sind drei umgesetzt,
(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Hat man viel geschafft!)
allerdings nicht mit den Mitteln und den Kapazitäten, die vorgesehen waren, und wir wissen alle: Insbesondere die Visegradländer, also Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei, aber auch die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben große Vorbehalte und stehen der Aufnahme von Flüchtlingen sehr kritisch gegenüber.
Großbritannien und Irland beteiligen sich nach den Verträgen nicht am Asylsystem. Dänemark hat ein Opt-out, das heißt, es kann sich aussuchen, ob es sich beteiligt oder nicht. Nur einige wenige Staaten nehmen zurzeit tatsächlich Flüchtlinge auf – bis die Belastungen und der innenpolitische Druck zu hoch werden. Wir haben die Entwicklungen verfolgt: In Schweden, Dänemark und Österreich gibt es strikte Grenzkontrollen, Obergrenzen und massive Verschärfungen des Asylrechts.
Jetzt geht es natürlich los. Man wollte etwas tun, nämlich 160 000 Menschen verteilen. Das funktioniert nicht. Jetzt kommt ein Bashing, und zwar in alle Richtungen, in erster Linie in Richtung der einzelnen Mitgliedstaaten. Es gibt Schuldzuweisungen und ganz merkwürdige, rechtsextreme Vorstellungen. Das mag ja sein; aber, meine Damen und Herren, diese Europäische Union, wie sie besteht, ist geprägt durch Vielfalt und Pluralismus – historisch, politisch und kulturell. Sie besteht gerade nicht aus gleichen Bürgern in gleichen Staaten, in gleichen Regionen.
Man kann hier nicht alle über einen Kamm scheren. Europa konnte bisher doch nicht nur funktionieren, weil alle Länder mit allen anderen Menschen in anderen Ländern Europas solidarisch waren, sondern auch, weil jeder Mitgliedstaat für sich große Vorteile gesehen hat. Das ist doch auch der Grund für die Ausnahmevorschriften in den vielen Protokollen. Wenn man es auf den Punkt bringt, dann könnte man die EU auch mit „Egoismus-Union“ übersetzen, aber das war sie doch von vornherein, das ist doch nichts Neues. Europa konnte nur funktionieren, weil man auch Rücksicht auf den anderen genommen hat.
Jetzt muss man Folgendes sehen: Diese ablehnende Haltung entsteht doch nicht in den einzelnen Regierungen und in ihren Gremien. Dort wird doch nicht überlegt: Was tun wir jetzt, wie können wir der EU jetzt dazwischenfunken? – „Wir wollen keine Flüchtlinge“: Das ist eine gefestigte und verwurzelte Haltung in der jeweiligen Bevölkerung; das müssen wir doch zur Kenntnis nehmen.
(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das stimmt doch nicht!)
Jetzt stellt sich die Frage: Setzen wir das EU-Recht mit Brachialgewalt um? Oder nehmen wir im Zuge unserer Politik auch darauf Rücksicht?
Herr Strengmann-Kuhn, Sie haben dazwischengerufen, aber ich sage Ihnen eines: Der Rechtsextremismus entsteht nicht, wenn Sie nicht genügend Sozialleistungen zur Verfügung stellen – das kann im Einzelfall einmal so sein –, er entsteht dann, wenn Sie gegen eine Stimmungslage, gegen Anschauungen in einer Bevölkerung mit Brachialgewalt und rücksichtslos Politik machen und nicht bedenken, welche Auswirkungen das hat. Was meinen Sie denn, warum überall in Europa zurzeit die Anzahl der Rechts- und Linksextremen ansteigt? Das liegt nicht an Verwerfungen im Sozialbereich, die sicherlich auch da sind.
Kollege Seif, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Ulrich?
Ja.
Vielen Dank. – Herr Seif, Sie sind jetzt der vierte Redner der Regierungskoalition. Schauen Sie sich die Presselandschaft an, denken Sie an Ihre eigenen Fraktionssitzungen der letzten Wochen: Man merkt, die Bundeskanzlerin schafft es nur noch, mit dem Thema einer europäischen Lösung die Regierung zusammenzuhalten, und ganz Deutschland wartet darauf, was denn die europäische Lösung sein soll.
(Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Herr Dörflinger hat sich ein bisschen distanziert, glaube ich!)
Sie sind jetzt der vierte Redner der Regierungskoalition, der keinen einzigen Satz dazu sagt, wie jetzt die europäischen Lösungen aussehen sollen. Finden Sie es verantwortbar für die Bundesregierung und für die Fraktionen der Bundesregierung, dass sie auch in dieser Debatte nur allgemein business as usual betreiben, oder wären Sie als einer der letzten Redner vielleicht bereit, jetzt einmal zu sagen, wie die europäische Lösung der Bundesregierung aussieht, was die Meinung Ihrer Fraktion ist und was bei dem EU-Gipfel in drei Wochen herauskommen soll? Denn mit einem Weiter-so, wie Sie es heute hier vertreten, werden Sie den Rechten in diesem Land weiter Auftrieb bescheren.
Vielen Dank, Herr Ulrich. Ich habe auf diese Zwischenfrage gewartet, weil ich eigentlich nicht genügend Redezeit habe, um über alle Themen zu reden.
(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Ich habe sie Ihnen organisiert!)
Zunächst einmal eines zur Klarstellung: Die Unionsfraktion ist etwas anderes als das, was Sie in der Öffentlichkeit sehen können. Wir sind Kollegen, die sehr intensiv in der Sache um das richtige Ergebnis ringen.
(Beifall bei der CDU/CSU – Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das also ist des Pudels Kern!)
Es gibt unter den Kollegen, die vielleicht einen anderen Ansatz haben – ich habe ja auch an einer Stelle einen weiteren Ansatz – und mit denen ich gesprochen habe, keinen einzigen, der sagt, dass die Bundeskanzlerin nicht die Richtige wäre, um uns gemeinsam erfolgreich durch diese Krise zu führen. – Das zunächst einmal als Vorwort.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Herr Ulrich, Sie können stehen bleiben. Ich bin noch nicht im Redetext angekommen. Sonst wird das von meiner Zeit abgezogen.
(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Dann stelle ich gleich noch eine Frage!)
– Sie können mir gleich noch eine Frage stellen.
(Gunther Krichbaum [CDU/CSU]: Das entscheidet die Präsidentin!)
Man muss auch sehen: Der Druck, den wir in Europa haben, folgt doch aus der hohen Zahl von Flüchtlingen. Die Umsetzung der europäischen Lösung wird in vielen Bereichen schon angegangen. Ganz wichtig ist die Fluchtursachenbekämpfung.
(Katja Kipping [DIE LINKE]: Die ist doch das Gegenteil davon!)
Da können wir nicht umhin. Ganz wichtig sind die Rückübernahmeabkommen; denn die Rückübernahme funktioniert nicht. Ganz wichtig sind auch weitere Einstufungen als sichere Herkunftsländer; wir reden hier über die Maghreb-Staaten. Das sind ganz wichtige Maßnahmen.
Wir müssen aber auch – das vermisse ich in der Tat in dem Programm; da bin ich dankbar für Ihre Frage – darüber nachdenken, ob bei der Schaffung des Asylrechts, das wir in Europa haben, die Entwicklung der heutigen Zeit vorhergesehen wurde. Die Genfer Flüchtlingskonvention wurde nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet. Da ging es um ganz andere Flüchtlinge, um viel weniger; dann hat man das erweitert.
(Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Viel weniger?)
– Es ging jedenfalls nicht um Fluchtbewegungen wie jene, die wir jetzt erwarten können,
(Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Was? – Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Aber in Europa gab es viel, viel mehr!)
bei denen es, wenn man genau hinschaut, um bis zu 100 Millionen Flüchtlinge geht. Solche Zahlen hat niemand vorhergesehen.
Eines ist klar: Bei der europäischen Lösung muss der Flüchtlingsschutz ganz vorne stehen. Aber wo der Flüchtling geschützt wird, wo wir ihm eine Perspektive geben – hier in Deutschland oder heimatnah, wo das Ganze für nur 10 Prozent der Kosten umsetzbar ist und wir viel mehr Menschen helfen können –, ist eine ganz andere Frage.
Die europäische Lösung muss auch ganz dringend bei der Anerkennungsrichtlinie ansetzen, die über die EU-Verträge hinausgeht. Da heißt es nur, dass ein subsidiärer Schutz bereitgestellt werden muss. Aber wir haben ihn in Europa sehr weit ausgeprägt, was es uns, wenn Bürgerkriegsflüchtlinge zu uns kommen, unmöglich macht, zu sagen: Bitte schön, wir haben an anderer Stelle mit den Vereinten Nationen die Möglichkeit geschaffen, dich sicher unterzubringen und dir eine Perspektive zu geben. – Das ist natürlich auch eine Zukunftsaufgabe.
Es ist beschämend, dass die Mittel im Bereich der Fluchtursachenbekämpfung in den letzten Jahren immer weniger wurden und im letzten Jahr nicht einmal die Finanzierung des Welternährungsprogramms und der wenigen Einrichtungen vor Ort, im Libanon, in Jordanien, sichergestellt wurde. – Herr Ulrich, Sie haben es gemerkt: Ich bin jetzt wieder bei dem Gedanken von vorhin.
(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Sie haben keine Antwort gegeben!)
– Doch. Wenn Sie zugehört haben: Das war die Antwort.
(Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Nein, Alex, nicht noch eine Frage!)
Jetzt kehren wir zu dem Gedanken zurück, den ich erwähnt hatte. Der Gedanke ist: Es spielt keine Rolle, dass es schwer ist, bei den Mitgliedsländern, die erhebliche Vorbehalte haben, eine andere Politik auf den Weg zu bringen; denn man sagt einfach: Wenn du nicht spurst, dann kriegst du eine Vertragsstrafe, dann entziehen wir dir die Finanzleistungen. – Damit wird man Europa nicht zusammenhalten können.
In der Sitzung des LIBE-Ausschusses vom 14. Januar hat Kommissar Avramopoulos ausgeführt, dass zukünftig die Reformvorschläge der Kommission zum Dublin-System auf dem Prinzip der Solidarität – das hört sich gut an – aufgebaut werden sollen und die Flüchtlinge mit einem festen Schlüssel automatisch den einzelnen Mitgliedstaaten zugewiesen werden sollen. Meine Damen und Herren, das wird der falsche Weg sein.
Wolfgang Schäuble hat letzte Woche in einer Rede darauf hingewiesen, dass eine gute Europapolitik immer auch nationale Erfahrungen berücksichtigen muss. Das gilt auch und gerade für die Integrationspolitik; denn nicht alle Gesellschaften durften in gleicher Weise die Vorzüge von Offenheit gegenüber Abschottung kennenlernen. Wir Deutsche erinnern uns an die Zeit der Wiedervereinigung. Damals haben wir aus genau diesen Erwägungen heraus die Vorbehalte der Menschen in Ostdeutschland berücksichtigt. Wir waren uns einig: Wir müssen das behutsam regeln, es geht nicht, dass man sich komplett aus dem System abmeldet; denn in irgendeiner Weise muss eine Kosten- und Lastenteilung stattfinden. Aber wir müssen das Vertrauen gewinnen, wir müssen ins Gespräch kommen. – Vorbild für die europäische Flüchtlingspolitik könnte durchaus das Modell sein, das wir nach der deutschen Wiedervereinigung umgesetzt haben.
(Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Begrüßungsgeld?)
Meine Damen und Herren, viele von uns sehen das Risiko, dass Europa an den großen Herausforderungen scheitern wird. Ich bin der festen Überzeugung: Europa kann das schaffen. Europa kann die anstehenden Herausforderungen hervorragend bewältigen und geht vielleicht sogar gestärkt daraus hervor. Aber wenn man keine Rücksicht nimmt, wenn man rücksichtslos an den Mitgliedstaaten vorbei agiert und meint, wir könnten von oben, von der Ebene der EU-Kommission durchregieren, dann sehe ich ein großes Risiko, dass dieses Europa scheitert.
(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Sagen Sie das mal Herrn Seehofer!)
Unabhängig von der zunehmenden Kritik war es zum Beispiel unvertretbar, dass der EU-Präsident Martin Schulz Polen bezichtigt hat, eine gelenkte Demokratie nach Putins Art zu sein. Das ist eine besonders geschmacklose Entgleisung, wenn man die historische und geografische Situation Polens bedenkt.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Ich komme zum Schluss. – Meine Damen und Herren, „Jetzt ist nicht die Zeit für Business as usual“, das ist absolut richtig. Eine einvernehmliche Lösung der Flüchtlingskrise in Europa wird aber nur möglich sein, wenn eine intensive und freundschaftliche Kommunikation mit den Ländern geführt werden wird, die Vorbehalte haben. Aber davon ist in der aktuellen Kommissionsarbeit und auch im Arbeitsprogramm 2016 leider nichts zu spüren.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Die Kollegin Andrea Lindholz hat für die CDU/CSU-Fraktion das Wort.
(Beifall bei der CDU/CSU)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/6479720 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 152 |
| Tagesordnungspunkt | Arbeitsprogramm der EU-Kommission 2016 |