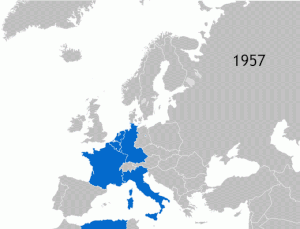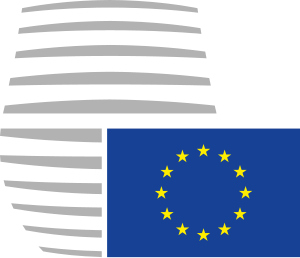Frank HeinrichCDU/CSU - EU-Jahresbericht über Menschenrechte und Demokratie
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt Themen, die sind von großer Bedeutung, und doch führen sie politisch ein Schattendasein; der eine oder andere Kollege hat darauf schon hingewiesen. Menschenrechte gehören sehr oft dazu.
Auch wenn wir die Bedeutung der Menschenrechte als ein Querschnittsthema, das alle Politikfelder durchzieht , in unserem Parlament begreifen und als solches formuliert haben – machen wir uns da doch nichts vor –: Debatten zu Menschenrechtsthemen finden oft vor leeren Rängen statt –
(Zuruf von der LINKEN: So ist es!)
Sie haben hier vorhin 36 Abgeordnete im Saal gezählt; ich weiß nicht, ob es inzwischen ein paar mehr geworden sind – und oft zu Zeiten, die nicht unbedingt zentral am Tag liegen.
Die humanitäre Hilfe oder auch die Entwicklungszusammenarbeit sind im Ranking der politischen Bedeutsamkeit ebenfalls ziemlich weit unten angesiedelt. Doch dann – plötzlich! – stehen ebendiese Themen direkt vor unseren Augen, im Zentrum der politischen Debatte. Man möchte fast sagen: im Auge des Sturms. Auch heute ist das so, nicht nur allein wegen des Menschenrechtsberichts, den wir heute behandeln und anlässlich dessen wir heute reden. Im Februar 2016 findet diese Debatte freilich unter einem neuen Namen statt, nämlich unter dem Begriff „Fluchtursachen bekämpfen“. Fluchtursachenbekämpfung ist das Gebot der Stunde; mein Kollege Thorsten Frei hat das eben sehr deutlich gemacht. Ich möchte daran hautnah anknüpfen.
Wir debattieren den Entwurf des EU-Jahresberichts 2014 über Menschenrechte und Demokratie in der Welt. Deshalb stimmt natürlich, dass wir sowohl die ganze Welt als auch uns selbst in Augenschein nehmen müssen. Die Welt hat sich seither aber gravierend verändert. Der Sommer 2015 war eine Zäsur für die Flüchtlingspolitik. Aber schon 2014 hat der Bericht festgestellt – ich zitiere –,
dass die verschiedenen Formen von Migration eine bedeutende Herausforderung für die Außenpolitik der EU darstellen, für die sofortige, wirksame und dauerhafte Lösungen erforderlich sind, damit sichergestellt werden kann, dass die Menschenrechte von Menschen in Not, wie etwa denjenigen, die vor Krieg und Gewalt fliehen, entsprechend den europäischen Werten und internationalen Menschenrechtsnormen geachtet werden.
Deshalb bekundet der Bericht
seine große Besorgnis und seine Solidarität mit den zahlreichen Flüchtlingen und Migranten, die als Opfer von Konflikten, Verfolgung, Versäumnissen der Regierungen, Schleusernetzen, Menschenhandel, extremistischen Gruppen und kriminellen Vereinigungen gravierenden Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind;
– insofern kommt das in dem Bericht doch vor; denn daran wird erinnert –
bekundet zudem tiefe Trauer angesichts der tragischen Todesfälle unter den Menschen, die versucht haben, die Außengrenzen der EU zu erreichen; …
Auch entsprechende Forderungen wurden in dem Bericht aufgestellt, nämlich – ich zitiere weiter -
dass es dringend notwendig ist, die Ursachen der Migrationsflüsse zu beseitigen und dazu die externen Aspekte der Flüchtlingskrise anzugehen …
Damit sind wir genau an dem Punkt, den mein Vorredner genannt hat. Wie gesagt, die Feststellungen und die Forderungen, die daraus abgeleitet wurden, sind schon im Rückblick auf das Jahr 2014 formuliert worden.
Schauen wir uns heute um, stellen wir uns die Frage: Wie steht die Welt an diesem Tag im Jahr 2016 da? Menschen ertrinken auf dem Weg über das Mittelmeer. Menschen werden auf der Balkanroute missbraucht und gedemütigt. Menschen sterben im Kugel- und Granatenhagel von Islamisten. Menschen verhungern als Folge von Bürgerkriegen und Umweltkatastrophen. Menschen flüchten, weil sie die Hoffnung auf eine Zukunft für ihre Kinder verloren haben. – Das kann und darf uns nicht kaltlassen, und – das zeigt auch unsere Debatte – das tut es auch nicht. Sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Politik lässt das nicht kalt.
Ich kann mich erinnern: Im vergangenen Jahr – noch vor dem Sommer – haben wir darüber gesprochen, und zwar kurz nach der Katastrophe mit den 700 Toten auf dem Mittelmeer. Ich erinnere mich, dass ich damals meine emotionalste Rede gehalten habe. Ich habe davon gesprochen, dass die Propheten des Alten Testaments in einem solchen Fall von Trauer und Elend ihren Mantel zerrissen haben, um auch anderen deutlich zu machen, was in ihnen vorgeht.
Wir müssen handeln. An dieser Stelle kann ich der Frau Bundeskanzlerin nur zustimmen, die gesagt hat:
Wenn wir jetzt noch anfangen müssen, uns dafür zu entschuldigen, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.
Schön ist, dass wir uns eben nicht zu entschuldigen brauchen. Um es klar zu sagen: Deutschland zeigt ein freundliches Gesicht. Die Welt schaut auf uns. Wir haben Verantwortung übernommen. Ich bin stolz auf das, was vor allem Bürger des Landes, aber inzwischen auch Verwaltungen bzw. viele Menschen an den Schaltstellen und auch die Politik auf den Weg gebracht haben. Navid Kermani hat es an dieser Stelle zu uns als Parlamentarier gesagt: „Danke, Deutschland.“
Dabei dürfen wir aber nicht naiv sein. Wir müssen die Befürchtungen ernst nehmen. Wir müssen unsere Ressourcen im Blick behalten. Wir müssen den sozialen Frieden im Inneren und in Europa sichern. Und wir müssen den Rechtsstaat ertüchtigen, um ihn handlungsfähig zu erhalten. Dazu gehört auch, dass wir am Schluss nur wirklich Schutzbedürftige aufnehmen.
Joachim Gauck hat es am Tag der Deutschen Einheit in einen, wie ich finde, prägnanten Satz gefasst: „Unser Herz ist weit. Aber unsere Möglichkeiten sind endlich.“ Darum hat der Deutsche Bundestag Asylpakete auf den Weg gebracht; wir haben ja unter anderem auch heute Morgen darüber diskutiert. Wir werden weiterhin Maßnahmen ergreifen, damit unsere Hilfe wirklich bei denen ankommt, die sie am dringendsten brauchen, bzw. da, wo die Menschenrechtsverletzungen gravierendst sind. Darum müssen und werden wir alles tun, soweit es in unserer Macht steht, um die Fluchtursachen konkret und nachhaltig zu bekämpfen.
Der EU-Jahresbericht weist dabei an vielen Stellen den richtigen Weg. Es steht zugleich außer Zweifel: An vielen Stellen bleibt er zu weich, und an anderen Stellen legt er da, wo noch kräftig etwas zu bearbeiten ist, den Finger in die Wunde. Dieser Bericht sagt auch, dass wir diesen Weg mit viel Elan und der nötigen finanziellen Ausstattung weitergehen müssen. Es sei daran erinnert, dass jeder Euro, den wir in die Fluchtursachenbekämpfung vor Ort investieren, ein Vielfaches an Geld spart gegenüber dem, was wir für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der EU investieren müssen.
Noch einmal – die vom Kollegen Frei genannten Zahlen waren einprägsam –: Die 1 000 Euro, mit denen wir jedem vor Ort nach allen Maßstäben der europäischen Menschenrechtswahrnehmung Sicherheit und Versorgung bieten können, reichen hier bei uns möglicherweise nur für einen Monat. Jeder Euro verringert menschliches Leid. Im Bericht wird deutlich, dass die EU und die Weltgemeinschaft einheitlich handeln und zusammenarbeiten müssen. Deshalb drängt Deutschland auf eine gemeinsame Lösung.
Der Bericht erinnert daran, dass die EU „verpflichtet ist, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ... zu entwickeln“. Gefordert werden „eine verstärkte Kohärenz“ – das Wort fiel mehrfach; da stimme ich laut zu – „zwischen der Innen- und Außenpolitik der EU“ – ich denke, das gilt auch für unser Land –, der „Ausbau der Zusammenarbeit und Partnerschaften mit den betroffenen Drittländern“ und eine engere Zusammenarbeit „mit den Vereinten Nationen und ihren Organisationen“, also denen, die auch daran arbeiten. Dafür muss sichergestellt werden, dass „die EU und ihre Mitgliedstaaten ... mit einer Stimme sprechen“, sodass man deren Botschaft dann auch tatsächlich hört.
Während wir hier debattieren und ich hier spreche, tagt der Europäische Rat. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird dort genau diese Position vertreten; sie hat uns das hier vor zwei Tagen deutlich gemacht. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Strategie zur Verteilung der Flüchtlinge, zur Sicherung der EU-Außengrenzen und zur Bekämpfung der genannten Fluchtursachen.
Was heißt das konkret? Das Hauptwerkzeug ist und bleibt der Menschenrechtsdialog; mehrere meiner Vorredner, auch der Staatsminister Roth, haben genau das erwähnt. Ein zentraler Gesprächspartner muss die Zivilgesellschaft sein. Doch wir müssen auch grundsätzlicher denken: Damit eine Zivilgesellschaft überhaupt Menschenrechtsverteidiger, Initiativen und NGOs hervorbringen kann, müssen die Grundbedürfnisse gestillt und die Grundmenschenrechte gewahrt sein, ohne das eine gegen das andere aufzuwiegen. Ich stimme vollkommen mit dem Entwicklungsminister überein, der die Schwerpunkte der EZ bei der Grundversorgung setzt. Der Gründer der Heilsarmee, William Booth, hat einmal gesagt: Einem hungrigen Magen kann man nicht predigen. – Übersetzt auf unser heutiges Thema bedeutet das: Von einem Menschen, der täglich um seine Existenz kämpft, kann ich nicht erwarten, dass er seine demokratischen Grundrechte wahrnimmt und eine veränderte Gesellschaft mitgestaltet. Das sind die drei Themen: Leben, Nahrung, Grundversorgung. Es ist keine Relativierung, wenn wir das eine und das andere fordern.
Es ist sicherlich richtig, dass in einem solchen wertenden Bericht mehrere Staaten, beispielsweise China, wegen Verletzung von Menschenrechten, die uns sehr wichtig sind, kritisiert werden. Aber wir müssen auch würdigen, dass in China in demselben Jahrzehnt, über das wir da reden, mehr als 100 Millionen Menschen aus extremer Armut herausgekommen sind.
Kollege Heinrich, kommen Sie bitte zum Schluss.
Ich komme zum letzten Absatz. Danke schön.
Um die elementaren Bedürfnisse wirklich zu erfassen und wirksam zu helfen, müssen wir die Schnittstelle zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit neu und eleganter definieren; das ist eine spannende Herausforderung. In der Anhörung am vergangenen Mittwoch waren sich alle Experten darin einig.
Kollege Heinrich, Sie haben zwar nichts über die Länge des Absatzes gesagt. Aber Sie müssen jetzt einen Punkt setzen.
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/6570164 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 156 |
| Tagesordnungspunkt | EU-Jahresbericht über Menschenrechte und Demokratie |