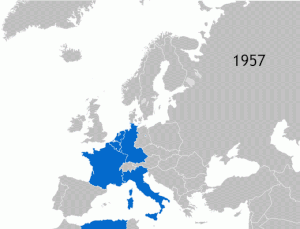Christoph BergnerCDU/CSU - Kultur und Geschichte der Deutschen in Osteuropa
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Wer sich mit der Entwicklung und Geschichte des Bundesvertriebenengesetzes beschäftigt, wird mitbekommen, dass diese Geschichte, die über 60 Jahre umfasst, durch ständige Modernisierungen, Novellierungen und Anpassungen an veränderte Verhältnisse gekennzeichnet ist. Ich erinnere an die Novellierungen, die mit dem Fall des Eisernen Vorhangs zusammenhingen und zu einer Neuordnung der Aussiedleraufnahme geführt haben. Ich erinnere auch an Anpassungen, die im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt unserer östlichen Nachbarn geschehen sind.
Dabei hat sich das Bundesvertriebenenrecht von einem Recht der unmittelbaren Kriegsfolgenbewältigung immer mehr zu einem Recht, das Beiträge zur nachhaltigen Friedenskonsolidierung leistet, gewandelt. Die vorgelegte Weiterentwicklung der Konzeption der Beauftragten für Kultur und Medien steht in genau diesem Kontext der Entwicklung: von unmittelbarer Kriegsfolgenbewältigung zu nachhaltiger Friedenskonsolidierung im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Neben die Verarbeitung des Kulturbruches nach Ende des Zweiten Weltkrieges durch Flucht und Vertreibung, neben die Herausforderungen, die seinerzeit geprägt waren durch die Rettung unmittelbar, akut gefährdeten Kulturgutes und die Notwendigkeit einer empathischen Erinnerungskultur für Vertriebene, neben diese Grundsätze, die nach wie vor Bedeutung haben, tritt immer mehr der Beitrag der deutschen Kultur im östlichen Europa zu einem gesamteuropäisch zu verstehenden kulturellen Erbe. Dies kommt, meine Damen und Herren, in der vorliegenden Konzeption überzeugend zum Ausdruck.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Sie verbindet die national-kulturellen Traditionen im Sinne eines gemeinsamen, nationenübergreifenden europäischen Kulturverständnisses. Nirgends ist mir das in jüngerer Zeit so deutlich geworden wie beim Besuch des Breslauer Oberbürgermeisters, der im Unterausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik über die Konzepte zum Programm des Kulturhauptstadtjahres berichtete. An den Ausführungen des Oberbürgermeisters ist klar geworden, dass die deutschen kulturellen Prägungen seiner Stadt zu einem europäischen Markenzeichen der Gegenwart geworden sind und wie wertvoll für ihn die Kombination aus deutscher Geschichte und deutschen Prägungen der Vergangenheit und dem europäischen Verständnis der Gegenwart ist.
In Erwiderung auf Frau Hupach möchte ich sagen: Wer anderes als die Deutschen selbst soll denn für die Pflege des deutschen Beitrages zu einem europäischen Kulturprojekt Verantwortung tragen? Niemand wird erwarten, dass wir das deutsche Kulturerbe gewissermaßen in die Hand von Polen und anderen zur Betreuung geben. Dann sollten wir uns auch darüber freuen, dass ein polnischer Oberbürgermeister unsere Kooperation bei der gemeinsamen europäischen Kulturpflege verlangt und fordert, und dafür bietet das Konzept sehr gute Voraussetzungen.
(Beifall bei der CDU/CSU – Sigrid Hupach [DIE LINKE]: Besser mal zuhören! Das war nicht meine Kritik!)
Ich hoffe, dass das Konzept auch dazu beitragen kann, zukünftige Herausforderungen zu bewältigen. Ich will nur ein Beispiel herausgreifen: Die Europäische Kommission und das Europaparlament haben 2018 zum Europäischen Kulturerbejahr ausgerufen. Unter dem Motto „Sharing Heritage“ sollen übergreifende, eine europäische Kulturidentität begründende Beispiele gesucht werden – insbesondere in der Bautradition. Ich bin mir sicher, dass Zeugnisse deutscher Kulturtradition im Osten wertvolle Beiträge dazu leisten können.
Als Beispiele nenne ich die Kirchenburgen in Siebenbürgen, den Kaschauer Dom in Kosice in der Slowakei mit seinem gotischen Turm – das östlichste gotische Bauwerk in Europa –, die Jahrhunderthalle in Breslau. Ich könnte diese Aufzählung fortführen, und ich möchte appellieren, dass auf der Basis des vorgelegten Konzeptes eine Beteiligung am Europäischen Kulturerbejahr in Erwägung gezogen wird.
Aber, meine Damen und Herren, die deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa gehen über die Grenzen der EU hinaus. Ein Anliegen ist mir hier besonders wichtig: Wir dürfen die Kultur der russlanddeutschen Kolonisten und ihr Deportations- und Vertreibungsschicksal nicht vergessen.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Ich bin froh, dass sich das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte im Konzept wiederfindet, und will nur darauf hinweisen, dass sich hier Begegnungsmöglichkeiten ergeben. Dies konnte ich gerade auch in der letzten Woche bei einem Besuch in Aserbaidschan wieder feststellen, als ich erlebte, dass dort – und zwar von der einheimischen Bevölkerung – Helenendorf und Annenfeld als deutsche Gründungen – die Deutschen sind 1941 deportiert worden – und die Schwabendörfer in der Gegend von Tiflis gepflegt werden und man zusammen die Feierlichkeiten zum 200. Jahrestag der Ansiedlung der Deutschen im Kaukasus in den Jahren 2017 und 2018 vorbereitet, den man gemeinsam begehen will.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an ein Wort unseres früheren Außenministers Hans-Dietrich Genscher, das mir sehr wertvoll geworden ist und das ich leider nur aus dem Gedächtnis zitieren kann. Auf einem Forum mit kasachischen Teilnehmern sagte Hans-Dietrich Genscher: In unserer Gesellschaft sollten wir Nachbarn nicht allein darüber definieren, ob wir eine gemeinsame Grenze haben, und wir sollten unseren Begriff von Nachbarschaft nicht nur auf eine gemeinsame Grenze beziehen. – Unter Verweis auf die Russlanddeutschen in Kasachstan, die weitgehend Nachkommen von Deportierten waren, sagte er weiter: Der Umstand, dass in kasachischen Dörfern deutsche Familien neben kasachischen Familien gelebt haben, macht uns zu Nachbarn im Sinne einer kulturellen Nachbarschaft.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Damit komme ich abschließend zu einem besonderen inhaltlichen Ansatz für diese Konzeption und für die Arbeit nach dem § 96 Bundesvertriebenengesetz: Wir haben die Chance, kulturelle Nachbarschaft zu gestalten. Wir sollten nicht immer wieder alte Feindbilder pflegen, die mit Blick auf das Bundesvertriebenenrecht nie richtig waren, und den Eindruck erwecken, Frau Schauws und Frau Hupach, als würde diese Arbeit Keile in unsere europäische Nachbarschaft treiben. Stattdessen sollten wir nach Gemeinsamkeit suchen.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Das Wort hat der Kollege Matthias Schmidt für die SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/6794658 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 168 |
| Tagesordnungspunkt | Kultur und Geschichte der Deutschen in Osteuropa |