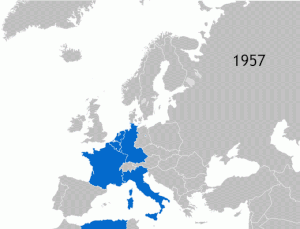Manuel SarrazinDIE GRÜNEN - 25 Jahre deutsch-polnischer Vertrag
Frau Präsidentin! Sehr verehrte Damen und Herren! Exzellenz Marganski! Als ich das erste Mal in den Zug stieg, um nach Polen zu reisen, wusste ich noch nicht, dass mich dieses Land von diesem Zeitpunkt an immer begleiten würde. Es ist für meine Generation – und in meinem Alter kann man anfangen, so zu reden; 1982 geboren, 1999 Schüleraustausch in Warschau – bezeichnend, dass wir die Europaenthusiasten sind, für die die Osterweiterung eines der wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben war. Am Tag des Referendums über den Beitritt Polens zur EU war ich zu einem Nachtreffen in Stettin. Die jungen Menschen strömten zur Abstimmung. Am Ende stimmten zwei Drittel der Bevölkerung für Europa. Das zeigt: Man kann Referenden über Europa gewinnen. Das ist heute vielleicht ein gutes Signal.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD)
Ich glaube, unsere wichtigsten Partner und Verbündeten in der Welt sind Frankreich, die Vereinigten Staaten von Amerika und Polen. Punkt! Ohne Polen gibt es meiner Ansicht nach keine Zukunft für die europäische Familie.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD)
Dass wir dies heute so sagen, liegt auch an dem Vertrag, über den wir heute sprechen. Das Besondere, die Genialität dieses Vertrages, der 1991 unterzeichnet wurde, ging zunächst von polnischer Seite aus. Schon in den 70er-Jahren im Pariser Exil hat die Kultura genauso wie die Solidarnosc in den 80er-Jahren und in der entscheidenden Zeit von 1989 bis 1991 verstanden: Ein freies Polen wird es nur mit einem vereinten Deutschland geben.
Mit dem Vertrag von 1991 hat Deutschland ein Versprechen gegeben. Deutschland hat das Versprechen gegeben, Polen in die westlichen Bündnisse NATO und EU zu führen, und es hat dieses Versprechen gehalten. Deutschland war vom Anfang der Verhandlungen bis zu den erfolgreichen Beitritten der Anwalt Polens. Das war wegweisend für eine lange Zeit von mehr als einer Generation. Auch deswegen sollten wir uns an den Vertrag heute erinnern: 1991 waren wir in der Lage, etwas zu formulieren, was 25 Jahre lang wegweisend war, und Versprechen zu geben, die wir 25 Jahre lang einhalten konnten. Abgesehen von der Tatsache, dass ich in Deutschland immer Polen und in Polen immer Deutschland verteidige – genauso wie viele von uns aus anderen Fraktionen –, kam mir der Gedanke, als ich über diese Rede nachgedacht habe: Vielleicht fehlt uns 25 Jahre nach dem Versprechen ein neues Versprechen; vielleicht ist das ein Teil des Problems des Sich-gegenseitig-Verstehens.
Hinzu kommt, dass die Osterweiterung, die meine Generation als unglaublich grandiosen Schritt wahrgenommen hat – sie ist vielleicht noch wichtiger als die Einführung des Euro –, viel zu wenig im Bewusstsein Deutschlands als größte Erfolgsgeschichte verankert ist, die Europa zumindest seit der dunklen Zeit des 20. Jahrhunderts zu verzeichnen hat. Die Osterweiterung war in der Lage, einen Systemumbruch herbeizuführen und eine historische Gerechtigkeit – das ist ein schwieriges Wort, aber ich sage es – zumindest teilweise wiederherzustellen. Dabei ist die Osterweiterung, wenn man ab 1991 rechnet, weitestgehend friedlich verlaufen; die 14 Menschen, die beim Sturm des Fernsehturms in Vilnius starben, werden wir niemals vergessen.
Diese Osterweiterung war so erfolgreich, weil sie es geschafft hat, Gesellschaften zu verändern, weil sie dabei Stabilität und Frieden geschaffen hat und weil sie es geschafft hat, fast alles zu verbessern, und zwar nicht nur in Polen, sondern auch hier. Der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands in den letzten Jahren ist meiner Ansicht nach ohne die Osterweiterung und ohne Polen nicht vollkommen zu verstehen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Deswegen – das hat Herr Nord gerade schon gesagt; das können Wahlkreisabgeordnete immer wundervoll darlegen – ist die deutsch-polnische Grenze heute immer noch Beweis der Kraft der europäischen Integration. Wenn man die Situation an der deutsch-polnischen Grenze in den letzten Jahrzehnten vergleicht – die Situation zunächst an der ostdeutsch-polnischen und dann an der gesamtdeutsch-polnischen Grenze –, dann muss man sagen, dass das vielleicht das größte Versprechen ist, das Europa abgeben kann. Vielleicht lautet das Versprechen, das wir einander neu geben müssen, dass wir nicht nachlassen in dem Versuch, einander gegenseitig zu verstehen, weil auch 25 Jahre nach dem Vertrag vieles schwer zu verstehen ist, aber vieles auch nicht verstanden werden will.
Das ist der Grund, warum wir uns am Ende nicht auf einen gemeinsamen Antrag einigen konnten. Es geht nicht darum, die Leistung von Vertriebenen nicht zu würdigen. Es geht auch nicht darum, nicht darüber zu reden, dass auch die Charta an gewissen Stellen Leistungen erbracht hat. Es geht darum, das zu kontextualisieren, weil die Formulierung des Rechts auf Heimat als Recht auf Rückkehr nach 1950 ein großes Problem für die Versöhnung war. Voraussetzung für die Versöhnung war, dass die Vertriebenenverbände und viele Menschen, die vertrieben worden sind, verstanden haben, dass es in der politischen Realität kein Wiederbekommen des Verlorenen auf Basis eines individuellen Rechtsanspruchs geben kann. Das war hart – das möchte ich würdigen –, aber es war notwendig, um die Aussöhnung möglich zu machen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN)
Wir sehen die Charta in ihrer Gesamtheit, auch aufgrund des wissenschaftlichen Forschungsstands dazu, nicht einseitig als Schritt in die richtige Richtung, sondern, wie Helga Hirsch es sagte, als Dokument von Radikalität und Mäßigung zugleich. Wir waren nicht bereit, darauf zu verzichten, dass der Forschungsstand in diesem Antrag abgebildet wird.
Ich mache mir wie die Kollegen Schäfer, Nord und Jung Sorgen, was den Weg Polens unter seiner neuen Regierung angeht. Ich finde es richtig, dass die Europäische Kommission diese Regierung in einen Dialog gebracht hat. Für mich war Polen immer ein Vorbild, wenn es um das Selbstverständnis einer freiheitlichen Demokratie ging. Wenn ich von den Eltern meiner Austauschpartner Geschichten über den Kriegsrechtszustand gehört habe, dann wusste ich, dass in diesem Land Demokratie sehr, sehr viel stärker gelebt wurde als in vielen anderen Ländern. Dieses Vorbild Polen möchte ich nicht verlieren.
Das heißt nicht, dass ich mit dem Finger auf Polen zeige. Ich höre von vielen Polen und aus allen Parteien, dass man sich Sorgen über den Weg Deutschlands macht, und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche Gründe, die ich politisch nicht teile, beziehen sich auf Flucht, Migration und Islam. Andere Gründe teile ich mehr. Dabei geht es um die Frage nach der Solidarität in Zeiten der Bedrohung, um unseren Blick auf die Ukraine und die östliche Nachbarschaft sowie um eine Tendenz zu einem Kerneuropa und das damit verbundene Beiseiteschieben Polens.
Ich glaube – ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin –, wenn wir es schaffen, in diesen Zeiten eine neue Idee zu finden, ein neues Versprechen für Deutschland und Polen in Europa, und dabei nicht in neue geschichtspolitische Debatten verfallen, dann ist das das Beste, was wir im Moment für die deutsch-polnische Freundschaft, aber vor allem auch am Tag des Brexit-Referendums für Europa tun könnten.
Danke sehr.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD)
Vielen Dank, Manuel Sarrazin. – Der nächste Redner in der Debatte: Dr. Christoph Bergner für die CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/6946552 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 179 |
| Tagesordnungspunkt | 25 Jahre deutsch-polnischer Vertrag |