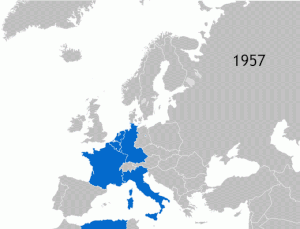Christoph BergnerCDU/CSU - 25 Jahre deutsch-polnischer Vertrag
Frau Präsidentin! Exzellenz! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mit einem Dank an meinen Kollegen Dietmar Nietan und sein Büro beginnen. Wir haben uns in der Arbeit der beiden Büros gemeinsam bemüht, sehr viele Anregungen, Vorschläge und Zuarbeiten, die wir nicht nur aus unseren Fraktionen, sondern auch aus der Zivilgesellschaft von Verbänden und Organisationen zu diesem Antrag erhalten haben, sachgerecht in einen gemeinsamen Antrag einzubinden. Ich erwähne das deshalb, weil die allermeisten dieser Zuschriften ungeachtet gelegentlicher politischer Irritationen, die aktuell in den deutsch-polnischen Beziehungen auftauchen, von dem Wunsch geprägt waren, Erfolge, Fortschritte, Positives der letzten 25 Jahre zu benennen, zu dokumentieren und gemeinsame Zukunftspläne und Projekte für die weitere deutsch-polnische Zusammenarbeit zu entwerfen.
Dies scheint mir wesentlich. Denn mir ist bei der Erarbeitung dieses Antrags erneut deutlich geworden: Der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit kennzeichnet eine Erfolgsgeschichte, und das vor dem Hintergrund einer Ausgangslage, die eine solche Entwicklung durchaus nicht selbstverständlich macht.
Als der Eiserne Vorhang 1989/90 fiel, gewannen die Appelle – Herr Schäfer hat sie schon verlesen – der unmittelbaren Nachkriegszeit wieder Bedeutung. In den Appellen ging es darum, die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen müssten die gleiche Qualität wie unsere Beziehungen zu Frankreich haben. Was nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen der alten Bundesrepublik und Frankreich an Aussöhnung und Verständigung im Westen möglich war, das müsse nun nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auch zwischen dem vereinten Deutschland und Polen möglich werden. Diese Appelle haben gewissermaßen Maßstäbe gesetzt. Aber so richtig und wichtig das darin formulierte Ziel war und bleibt, so unvergleichbar ist doch die Ausgangslage, was unser Verhältnis zu Frankreich und zu Polen betrifft.
Auf dem deutsch-polnischen Verhältnis liegen spezifische historische Lasten, die insbesondere mit dem von Deutschland losgebrochenen Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen zu tun haben. Ich denke, es ist deshalb unverzichtbar, dass wir uns bewusst machen, dass der Zweite Weltkrieg für Polen nicht nur vom Überfall, sondern auch vom Terror gegen die Zivilbevölkerung im besetzten Polen bestimmt war. Es gab Vertreibungen im Rahmen des Generalplans Ost, bei denen rund 1,5 Millionen Polen zwangsumgesiedelt und 200 000 polnische Kinder zwangsgermanisiert wurden. Rund 600 000 Polen wurden zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich deportiert. Nicht zu vergessen sind die Schrecken des Holocaust auf polnischem Boden und, weil der Hitler-Stalin-Pakt die Voraussetzung war, auch der Terror im sowjetisch besetzten Ostpolen.
Das alles sind Traumata, die spezifische historische Belastungen ausmachen. Es beeindruckt und berührt mich immer wieder, wenn ich in der Warschauer Altstadt durch Straßen gehe, in denen an jedem Haus eine Erinnerungstafel hängt, die von Erschießungen oder Kampfhandlungen der Besatzungszeit zeugen.
Aber zu diesen schweren historischen Belastungen gehören auch die Traumata deutscher Betroffenheit: Heimatverlust, Flucht, Vertreibungen Millionen Deutscher und Zwangsassimilation der relativ wenigen in der Heimat verbliebenen Deutschen unter der kommunistischen Herrschaft.
Mich wundert nun nicht, dass wir bei der Erarbeitung unseres Antrags gewissermaßen mit den positiven Seiten so schnell fertig waren, aber den Absatz über den Prozess der Nachkriegsaussöhnung am meisten diskutiert, am häufigsten umformuliert haben und mit Manuel Sarrazin zu guter Letzt keine Einigung erreichen konnten.
Einigkeit bestand in der Würdigung und beim Dank an die Polen, die nach den schrecklichen Kriegserfahrungen die Hand zur Versöhnung ausgestreckt haben. Wladyslaw Bartoszewski steht beispielhaft dafür. Anerkennung gebührt den Deutschen, die den Weg der Gemeinsamkeit gesucht und gestaltet haben. Wir glauben, dass bei diesem letzten Aspekt zumindest unter den Gesichtspunkten des Gewaltverzichtes und der Mitgliedschaft in der Europäischen Union die Charta der deutschen Heimatvertriebenen nicht unerwähnt bleiben sollte.
Herr Dr. Bergner, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung vom Kollegen Sarrazin? – Bitte schön.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir in den Verhandlungen immer bereit waren, diese Brücke zu nehmen, obwohl das für uns natürlich auch nicht leicht ist.
Wenn Sie die vorliegenden Anträge vergleichen, sehen Sie, dass wir im Textentwurf auch die Charta der deutschen Heimatvertriebenen würdigen. Denn wir würdigen auch diejenigen deutschen Heimatvertriebenen,
die sich im Geiste der Versöhnung engagierten und die den in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen vom 5. August 1950 geforderten Gewaltverzicht und den Appell für europäische Lösungen zur Richtschnur ihrer Arbeit machten,
– und wir fügen hinzu –
auch wenn die Charta aufgrund des Postulats eines Rechts auf Heimat im Verständnis eines Rechts auf Rückkehr und aufgrund der Vorgeschichte einige ihrer Unterzeichner in ihrer Versöhnungsleistung historisch nicht unumstritten ist.
Dieser Zusatz war der Stein, über den Ihre Fraktion nicht springen wollte. Das gemeinsam festzuhalten, ist vielleicht eine Grundlage für Debatten oder Diskussionen untereinander zu einem späteren Zeitpunkt, die nicht mehr an solchen Steinen hängen bleiben. Aber mir ist trotzdem wichtig, festzuhalten, dass wir nicht die Versöhnungsleistung der Charta insgesamt infrage stellen wollten, obwohl auch diese in Teilen der Historiografie schon sehr umstritten ist. – Danke.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Lieber Kollege Sarrazin, ich habe es am meisten bedauert, dass wir uns in diesem Punkte nicht einigen konnten. Ich will als Erwiderung aus meiner Sicht noch einmal deutlich machen, wo der Unterschied liegt und weshalb er mit der nachgeschobenen Formulierung nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Das ist dem Umstand geschuldet, dass wir bei der Charta der Heimatvertriebenen eine unterschiedliche Wahrnehmung in Deutschland und in Polen haben.
Ich habe nun – du wirst es auch getan haben – genug Gespräche mit polnischen Vertretern und Kollegen geführt. Klar ist, dass im Nachkriegspolen der Verzicht auf Rache und Vergeltung aus polnischer Perspektive seinerzeit als Zynismus betrachtet wurde. Man sagte: Hier ist eine Untäternation, und sie verzichtet großzügig auf Rache und Vergeltung. – In umgekehrter Weise ist die deutsche Perspektive zu betrachten. Man stelle sich nur einmal vor, die Vertriebenen wären 1950 nicht zu diesem Bekenntnis in der Lage gewesen: Welch problematische Entwicklung für die Bundesrepublik Deutschland und für Europa wäre daraus entstanden! Für Deutschland war dieser Verzicht eine ungeheure Leistung.
Wenn ich das noch anfügen darf: Unser Bundestagspräsident hat bei seiner Rede zum Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung eine ganz wichtige Bemerkung gemacht. Er sagte: Wenn man angesichts historischer Entwicklungen in beiden Ländern eine unterschiedliche Wahrnehmung hat, sollte man diese Wahrnehmung nicht verschweigen, weil sie unterschiedlich ist, sondern man sollte sich über die unterschiedlichen Wahrnehmungen austauschen. – Das ist das Anliegen, das wir mit unserer Formulierung vertreten, weshalb wir den Gedanken, der der Charta der deutschen Heimatvertriebenen anhaftet, in dieser Weise in den Antrag eingebaut haben.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Meine Damen und Herren, Aussöhnung erreicht man – wenn ich daran anknüpfen darf – also nicht, wenn man unterschiedliche Wahrnehmungen nicht offen und respektvoll austauscht. Das haben wir versucht.
Ich darf mit einer persönlichen Bemerkung schließen, anknüpfend an Manuel Sarrazins Erinnerungen an die erste Polen-Reise. Meine erste längere Reise als Student 1969 durch Polen – mit vielen Bekanntschaften und Begegnungen – endete an der Grenzkontrolle in Frankfurt, wo mir als DDR-Bürger der DDR-Zoll Broschüren und Schallplatten, die mir zum Teil von polnischen Bekannten geschenkt worden waren, abnahm, weil sie – so waren die Zollbestimmungen – nicht dem fortschrittlichen Kulturschaffen des besuchten Brudervolkes entsprechen.
(Vereinzelt Heiterkeit)
Meine Damen und Herren, damals, als mir der Zollbeamte der DDR diese Dinge der polnischen Freunde abnahm, ist mir eines klar geworden: Die ideologischen Gemeinsamkeiten, die zwischen der Regierung der DDR und den Regierungen bzw. Staatsführungen der Volksrepublik Polen bestanden, hatten sehr wenig mit wirklicher deutsch-polnischer Aussöhnung und Freundschaft zu tun. Die wirkliche deutsch-polnische Aussöhnung und Freundschaft hat mit dem Fall des Eisernen Vorhangs richtig beginnen können, und sie hat im europäischen Einigungsprozess eine würdige Fortsetzung gefunden. Dafür bin ich dankbar, und darüber sollten wir uns gemeinsam freuen.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie der Abg. Marieluise Beck [Bremen] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Vielen Dank, Dr. Bergner. – Das Wort hat Dr. Bernd Fabritius für die CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/6946554 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 179 |
| Tagesordnungspunkt | 25 Jahre deutsch-polnischer Vertrag |