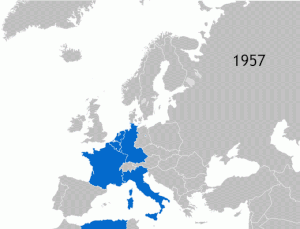Hans-Peter FriedrichCDU/CSU - Auswärtiges Amt
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zur Abrundung der Außenpolitik darf die Europapolitik nicht fehlen, wenngleich wir uns in den letzten Jahrzehnten angewöhnt haben, die Europapolitik weniger als Außenpolitik anzusehen, sondern eher als europäische Innenpolitik; denn die europäische Integration, der Fortgang der Integration, die Erweiterung der Europäischen Union kamen uns selbstverständlich vor. Wir dachten, dass das alles automatisch weitergeht.
Heute, im Jahr 2016, schauen wir auf eine Europäische Union, die in schweres Fahrwasser geraten ist; „Brexit“ ist ein Begriff, der das zum Ausdruck bringt. Der Aufstieg der europafeindlichen Parteien in vielen Ländern – ich spreche bewusst nicht von europakritischen, sondern von europafeindlichen Parteien –, die den Menschen erzählen wollen, dass es auch ohne Europa gehen könnte, nimmt zu, obwohl jeder begreifen müsste, dass es für die europäischen Länder nur eine gemeinsame Zukunft geben kann. Wir werden die Zukunft entweder gemeinsam gewinnen, oder wir werden gemeinsam absteigen.
Wir stellen plötzlich fest, dass es in fundamentalen Fragen der Politik Konflikte zwischen den Mitgliedstaaten gibt, die sehr emotional und vehement ausgetragen werden. Wir stellen fest, dass es ein zunehmendes Misstrauen vor allem kleinerer Mitgliedstaaten gegenüber der Kommission, aber auch gegenüber größeren Mitgliedstaaten in Europa gibt. Es reicht eben nicht aus, dass sich Deutschland, Frankreich und Italien in der Europapolitik einig sind, sondern wir müssen viele andere Länder mitnehmen; ansonsten werden wir dieses Europa nicht in die Zukunft führen können. Das ist derzeit unser Problem.
Günther Oettinger hat vor kurzem gesagt: Das europäische Projekt ist in Lebensgefahr. – Ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube aber nicht, dass das nur am Fehlverhalten einzelner Politiker auf unterschiedlichen Ebenen liegt. Vielmehr gibt es im europäischen Integrationsprozess zwei Grundprobleme, die wir in den letzten Jahrzehnten nie korrigiert haben und die noch mit der Phase der Gründung der Europäischen Gemeinschaft vor 60 Jahren zusammenhängen. Damals hat man gesagt: Wir wollen möglichst schnell möglichst viel zusammen machen. – Damit das möglichst schnell geht, hat man entschieden: Die Parlamente lassen wir außen vor. Wir bilden als Exekutive eine Kommission, die auch Gesetzgebungskompetenzen bekommt und die von einem Rat – auch da haben wir wieder die Exekutive – kontrolliert wird. – Diese Übermacht der Exekutive, die vor 60 Jahren verständlich und richtig war, zieht sich bis heute durch. Auch der Versuch einer Korrektur in den 70er-Jahren durch die – halbherzige – Einführung eines Europäischen Parlaments hat daran nichts geändert.
Der zweite Fehler war: Man wollte möglichst umfassend zusammenarbeiten und möglichst viel zusammen machen, egal was. Damals, vor 60 Jahren, war es richtig, zu sagen: Alles, was wir gemeinsam machen, ist für das gemeinsame Friedensprojekt Europa stabilisierend. – Es gab einen Grundsatz, den heute noch das Europäische Parlament und die Kommission, aber auch der EuGH vertreten: Bei Kompetenzkonflikten wird im Zweifel immer zugunsten der Gemeinschaft und immer zulasten der einzelnen Mitgliedstaaten entschieden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese beiden Webfehler müssen wir korrigieren, wenn dieses europäische Projekt eine Zukunft haben soll. Wir müssen dafür sorgen, dass das parlamentarische Element bei den Entscheidungen in Europa gestärkt wird. Das kann man am besten und schnellsten dadurch erreichen, dass man möglichst viele Kompetenzen auf die Mitgliedstaaten, die nationale Ebene und die nationalen Parlamente in den jeweiligen Staaten zurückverlagert.
Zudem brauchen wir einen Paradigmenwechsel bei Kompetenzkonflikten. Im Zweifel müssen die Mitgliedstaaten zuständig sein. Das hat etwas mit dem zu tun, was Norbert Röttgen angesprochen hat, mit Identität. Es geht nicht nur um die Identität Europas im Vergleich zur Identität anderer Erdteile, sondern auch um die Identität einzelner Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union. Unsere europäischen Freunde und Mitbürger wollen ihre Identität behalten: in ihrer Region, in ihrer Heimat, in ihren Ländern. Deswegen ist es wichtig, diesen Paradigmenwechsel vorzunehmen und zu sagen: Im Zweifel sind die Mitgliedstaaten zuständig, es sei denn, wir können eindeutig und für jeden einleuchtend begründen, warum es einen Mehrwert hat, etwas gemeinsam auf europäischer Ebene zu machen.
Ich will die einzelnen Bereiche, in denen offensichtlich ist, dass wir zusammenarbeiten müssen und nur gemeinsam vorgehen können, beispielhaft benennen.
Erstens: die äußere Sicherheit. Die meisten Experten sind sich einig: Egal wie die Wahlen in den USA ausgehen werden, die Amerikaner werden sich zunehmend aus der Verantwortung für die Verteidigung Europas zurückziehen. Wir Europäer werden künftig selber in der Lage sein müssen, uns zu verteidigen. Wir brauchen deswegen eine starke Säule der NATO in Europa.
Deswegen wäre es das wichtigste und vordringlichste Ziel der Europäischen Union, jetzt dafür zu sorgen, dass wir eine Vernetzung und Abstimmung der militärischen Fähigkeiten bekommen und dass wir in der Lage sind, unseren Bürgern in Europa, vom Baltikum bis zur Iberischen Halbinsel, zu sagen: Wir sind in der Lage, euch vor allen zu verteidigen, die es nicht gut meinen mit Europa.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Das zweite Thema, das Thema „Innere Sicherheit, Bekämpfung organisierter Kriminalität und Terrorismus“, beginnt mit dem Schutz unserer Außengrenzen. Weder ein Staat noch ein Staatengebilde wie die Europäische Union werden das Vertrauen ihrer Bürger haben, wenn sie nicht in der Lage sind, das Territorium zu schützen. Deswegen gehört es zur allerwichtigsten Voraussetzung, dass wir die Außengrenzen Europas schützen, und zwar wirksam, und dass wir dazu übergehen, die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Europa noch effizienter zu organisieren als bisher. Das betrifft sowohl Fragen des Terrorismus als auch der organisierten Kriminalität; denn eines versteht jeder Mensch in Europa: Da die Banden europäisch bzw. international organisiert sind, müssen wir in Europa zusammenarbeiten, wenn wir ihnen das Handwerk legen wollen. Es versteht jeder Mensch, dass man den Terrorismus, der ein europäisches Problem geworden ist, nur gemeinsam europäisch bekämpfen kann. Deswegen kann man an diesen Beispielen auch deutlich machen: Da hat Europa einen Mehrwert.
Ich nehme ein drittes Beispiel: Energiepolitik. Ein Land hat viel mehr Sicherheit für seine Energieversorgung und eine stärkere Unabhängigkeit von anderen Mächten, wenn es einen sehr effizienten und vielschichtigen Energiemix hat. Es muss uns gelingen, einen europäischen Energiemix breit aufzustellen, der sowohl die Sonnenenergie von Spanien als auch die Kernenergie von Frankreich auch für das Baltikum verfügbar macht, wenn die Russen kein Gas mehr liefern wollen. Deswegen brauchen wir eine gemeinsame europäische Energiepolitik.
Herr Außenminister, ich will ganz ehrlich sagen: Mir gefällt nicht, dass wir zulassen, dass um Polen herum eine Nord-Stream-Leitung gebaut werden soll, die ganz klar nur ein Ziel hat, nämlich unsere polnischen Nachbarn auszugrenzen. Ich denke, dass diese Entscheidung nicht gut für den europäischen Geist wäre; vielmehr müssen wir dafür sorgen, dass auch in der Energiepolitik eine europäische Gemeinsamkeit auf allen Ebenen entsteht.
Das Gleiche gilt für den Bereich der Infrastruktur – bei Straßen, Schienen, Leitungen ist das überhaupt keine Frage –, aber auch für die Digitalisierung. Da gilt das, was Norbert Röttgen vorhin gesagt hat: Rechtsetzung. Man kann Recht setzen, aber man muss dieses Recht auch durchsetzen können. Es kann nicht jedes Land für sich genommen den Googles dieser Welt entgegentreten. Aber 500 Millionen Verbraucher, der größte Verbrauchermarkt der Welt, sind in der Lage, mit Macht seine Rechtsetzung gegenüber den Googles dieser Welt durchzusetzen. Daran können wir unseren Bürgern verdeutlichen, warum wir Europa auch in der Frage der Digitalisierung brauchen.
(Zuruf von der SPD: Auch bei den Steuern!)
Schließlich – das wurde schon angesprochen – das Thema Afrika. Wir als Europäer haben eine Verantwortung für Afrika, nicht zuletzt deswegen, weil wir in den letzten 200 Jahren in Afrika selber genügend Unruhe angezettelt haben. Ich glaube, dass wir nur gemeinsam – die Konferenz von Valetta war ja ein guter Anfang – eine verantwortungsvolle Afrikapolitik in Europa zustande bringen können. Jedes einzelne Land wäre überfordert. Auch das verstehen die Bürgerinnen und Bürger in Europa. Auch da kann man ihnen klarmachen, warum man Europa braucht, um die große Herausforderung, den Menschen in Afrika eine Perspektive zu geben, gemeinsam annehmen zu können.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es uns nicht gelingt, jetzt mit grundlegenden Reformen die Webfehler der europäischen Integration der letzten Jahrzehnte zu korrigieren, werden wir dieses europäische Projekt strangulieren. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Ich denke, dass wir alle Kraft darauf verwenden müssen.
Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Für die SPD spricht jetzt der Kollege Frank Schwabe.
(Beifall bei der SPD)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/6999327 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 186 |
| Tagesordnungspunkt | Auswärtiges Amt |