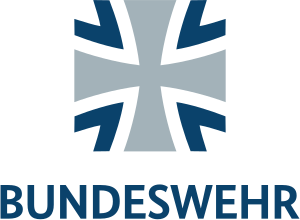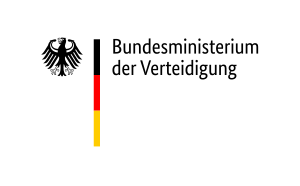Christian Lindner - Einbringung Haushaltsgesetz 2024, Finanzplan des Bundes 2023 bis 2027
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Geschäftsordnungsdebatte hat mindestens eines gezeigt: dass alle gut erholt aus der sitzungsfreien Zeit zurückgekehrt sind.
(Heiterkeit bei Abgeordneten der FDP und der SPD)
Ich freue mich, Sie alle zu sehen – vertraute Gesichter, auch ein ungewöhnliches Gesicht hier im Plenarsaal. Mein Eindruck ist: Das Sehfeld des Bundeskanzlers ist zeitweilig
(Friedrich Merz [CDU/CSU]: Nach links!)
nach rechts begrenzt; vermutlich beginnt es etwa vorne ab der Reihe der CDU/CSU. Vielleicht findet er demokratischen Trost in den nächsten Tagen darin.
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Friedrich Merz [CDU/CSU]: Ganz links, genau!)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute den Entwurf des Bundeshaushaltes für das Jahr 2024 und die Finanzplanung für die nächsten Jahre. Es ist kein Geheimnis: In diesem Etatentwurf steckt viel Arbeit im Bundeskabinett. Das überrascht nicht; denn die Anstrengung, mit der wir konfrontiert sind, ist vergleichbar mit der in den Jahren 2010/2011. Damals ging es um den Weg unseres Landes hin zur Erreichung der Schuldenbremse. Heute geht es um die Rückkehr zur Schuldenbremse oder – genauer gesagt – zu langfristig tragfähigen Staatsfinanzen. Für die Bundesregierung ist klar: Auf Krisen muss dieser Staat entschlossen reagieren, und er muss auch seine fiskalischen Möglichkeiten mobilisieren, wenn es notwendig ist. Aber wer den Ausstieg aus der Krisenpolitik nicht findet, der gefährdet dauerhaft die Stabilität unseres Gemeinwesens.
(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Dennis Rohde [SPD])
Das deutlichste Signal für den notwendigen haushaltspolitischen Kurswechsel senden die Zinsen. Befanden wir uns im vergangenen Jahr, wie ich gesagt habe, noch vor einer Steilwand, so sind wir nun auf dem Hochplateau angekommen. Hier ist die Luft merklich dünner geworden. Für das nächste Jahr rechnen wir mit rund 37 Milliarden Euro an Zinsausgaben. Das ist eine Verzehnfachung im Vergleich zum Jahr 2021.
(Zuruf von der CDU/CSU: Das liegt an den Schulden!)
Die Zinskosten im Bundeshaushalt sind mittlerweile doppelt so hoch wie der Etat der Bildungs- und Forschungsministerin. Die Botschaft ist deshalb klar: Wir können uns uferlos neue Schulden schlicht nicht erlauben; sie wären nicht finanzierbar.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD – Zuruf des Abg. Peter Boehringer [AfD])
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Umfeld ist herausfordernder als vor gut zehn Jahren. Wir müssen mit einer hohen Inflation umgehen; ich komme gleich darauf zurück. Wir haben keine prosperierende Wirtschaft, sondern wir müssen unser Wachstum aus konjunkturellen und strukturellen Gründen verbessern. Vor allen Dingen aber haben wir neue sicherheitspolitische Herausforderungen aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine. Die Verhandlungen im Kabinett waren deshalb einerseits von großem Ernst geprägt, andererseits aber auch von dem nachvollziehbaren und begrüßenswerten Engagement für die Interessen und Anliegen der einzelnen Ressorts. Am 5. Juli haben wir dann im Bundeskabinett den Entwurf des Bundeshaushaltes und den Finanzplan bis 2027 beschließen können. Trotz oder wegen der anstrengenden Vorbereitungen im Kabinett können wir jetzt einen Etat vorlegen, der der Lage entspricht, und dafür bedanke ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen im Kabinett und beim Bundeskanzler sehr herzlich.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Es gibt viele Bedenken, und es gibt viel Kritik in der Öffentlichkeit und aus dem parlamentarischen Raum. Und ja, es stimmt auch: Wir mussten zwischen dem prinzipiell Wünschbaren und dem jetzt Dringlichen und Notwendigen unterscheiden. Die Ressorts haben beispielsweise – mit Ausnahme des Bundesministeriums der Verteidigung – eine Summe von jährlich 3,5 Milliarden Euro im nächsten und übernächsten Jahr beitragen müssen. Durch diese und andere Maßnahmen konnten wir die Gesamtausgaben gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr deutlich senken. Wir planen nun mit 445,7 Milliarden Euro und damit mit rund 30 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr. Gleichwohl liegen die Gesamtausgaben 2024 nominal noch rund 25 Prozent über dem Vorkrisenniveau von 2019.
(Zuruf von der AfD: Hört! Hört!)
Von einem Kahlschlag kann also keinesfalls die Rede sein.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Vielmehr, meine Damen und Herren, scheint es mir so, dass mit den Krisen der vergangenen Jahre eine wachsende Erwartungshaltung gegenüber dem Staat einherging, bei jedem Problem mit finanzieller Hilfe zu unterstützen.
(Lachen des Abg. Peter Boehringer [AfD])
Wir haben uns an Leistungen und Zuwendungen gewöhnt. Bei der Konsolidierung der Staatsfinanzen geht es also jetzt um nicht weniger als darum, nach Jahren der massiven Staatsintervention wieder eine vernünftige Balance zwischen Staat und Privat zu lernen. Dieser Anspruch, alle Aufgaben und Probleme mit öffentlichem Geld zu lösen, konnte in der Vergangenheit nie erfüllt werden, er wird in der Zukunft nie finanzierbar sein, und im Übrigen sollte er auch nicht Leitbild eines freiheitlich verfassten Gemeinwesens sein.
(Beifall bei der FDP – Peter Boehringer [AfD]: Warum machen Sie es dann?)
Es geht jetzt um die Anerkennung finanzieller Realitäten nach Jahren, in denen Geld scheinbar keine Rolle spielte. In Wahrheit hat der niedrige Zins schon vor der Pandemie die Optik verzerrt.
Wir müssen uns neu fokussieren. Mit dem Haushalt 2023 sind wir daher im Kernhaushalt zur Schuldenbremse zurückgekehrt. Mit den Preisbremsen im Wirtschaftsstabilisierungsfonds, dem Sonderprogramm für die Bundeswehr und der Nutzung der allgemeinen Rücklage war dies ein wichtiger, aber nur ein erster Schritt in Richtung einer Normalisierung der Haushaltspolitik.
Mit dem Haushalt 2024 gehen wir die nächsten Schritte. Weiterhin achten wir die Schuldenbremse im Kernhaushalt. Wir reduzieren die Rücklage. Im Jahr 2024 – ich komme später noch darauf zurück – wird auch die Nutzung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds enden. Die Neuverschuldung wird so massiv zurückgefahren: von 45,6 Milliarden Euro, die wir für das Jahr 2023 planen, auf 16,6 Milliarden Euro im kommenden Jahr.
In den Jahren danach werden wir aber weitere Schritte gehen müssen, um bestehenden Handlungsbedarf zu decken, also um die Lücke zwischen geplanten und erwarteten Einnahmen und Ausgaben zu schließen. Nochmals gesagt, damit kein Missverständnis aufkommt: Es war richtig, in Zeiten von akuten Krisen finanzpolitisch gegenzusteuern; nun ist es aber wichtig, wieder fiskalische Resilienz zu gewinnen. Die Schuldenstandsquote darf nicht von Krise zu Krise weiter ansteigen. Vererbt der arme Onkel Schulden, kann man das Erbe ausschlagen. Beim Bundeshaushalt funktioniert das nicht, und deshalb haben wir auch eine moralische Verantwortung gegenüber denjenigen, die nach uns kommen.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD)
Übrigens nehme ich manche Kritik der Opposition und namentlich auch des Bundesrechnungshofes sehr ernst. Ich komme gleich noch mal bei einzelnen Punkten darauf zurück. In der Strategie jedoch müssen wir uns an nüchternen Zahlen orientieren. Diese nüchternen Zahlen – egal ob Kernhaushalt oder Nebenhaushalt – lassen sich an einer Ziffer festmachen, nämlich der Verschuldungsquote dieses Staates, gemessen an seiner Wirtschaftsleistung. Bezogen auf unsere Wirtschaftsleistung, wird die Schuldenquote in wenigen Jahren deutlich in Richtung des Vorkrisenniveaus sinken.
(Lachen bei Abgeordneten der AfD)
Viel schneller, als manche heute glauben, werden wir mit unserer jetzigen Haushaltsstrategie das Vorkrisenniveau bei der Staatsverschuldung wieder erreicht haben. Und das ist auch notwendig; denn unser Land ist der Goldstandard der Staatsfinanzierung. Unser Triple-A-Rating und unsere Glaubwürdigkeit gegenüber den Kapitalmärkten geben uns Handlungsfähigkeit, und zwar nicht nur dem Bundeshaushalt, sondern auch den Haushalten von Ländern und Gemeinden. Deshalb ist es von überragender Bedeutung, diese Glaubwürdigkeit gegenüber den internationalen Kapitalmärkten durch solide Haushaltspolitik zu behaupten.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Diese Glaubwürdigkeit, die wir an den Kapitalmärkten genießen, und die Art und Weise, wie von uns begebene Anleihen auf den Märkten platziert werden, widerlegen jede Kritik von Ihnen.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Zuruf von der AfD: Das sehen wir aber anders!)
Wenn man sich den Haushalt ansieht, stellt man fest: Es gab Konsolidierungsnotwendigkeiten. Es wird nicht alles so finanziert, wie man sich das wünscht, und deshalb gibt es auch an einzelnen Positionen Kritik, der wir uns stellen müssen. Es gibt Kritik aus der deutschen Wirtschaft. Es gibt Kritik von Sozialverbänden, aus dem Sport. Es gibt Kritik der Opposition. Es gibt Anregungen der Koalitionsfraktionen. Das ist bei einer Konsolidierungsaufgabe, wie wir sie haben, auch kein Wunder. Bei der Konsolidierung, die wir vorhaben, wird es im einzelnen Gewinner und Verlierer, Pro- und Kontraargumente geben. Entscheidend aber wird am Ende sein, ob ein Ergebnis erreicht wird, das von allen Seiten als fair betrachtet werden kann, sprich: dass Belastungen und Entlastungen gerecht verteilt sind. Scherzhaft gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen: Wenn die Kritik von allen Seiten kommt, scheint das Ergebnis ausgewogener zu sein, als wenn sich nur eine Seite beschweren würde.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD)
Wir haben ein herausforderndes ökonomisches Umfeld: einerseits aufgrund der Inflation, andererseits aufgrund des Wachstums, das uns nicht zufriedenstellen kann. Die Inflation in Deutschland ist zu hoch. Die Inflation ist eine unsoziale wirtschaftliche Entwicklung. Sie gefährdet, dass Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Sie macht Menschen Sorge und Angst, dass sie vielleicht das Ersparte verlieren können. Die Inflation gefährdet auch die Investitionssicherheit an einem Standort wie Deutschland.
(Zuruf von der CDU/CSU: Tun Sie was dagegen!)
Sie ist in der Lage, unser ökonomisches Fundament zu unterspülen, und deshalb ist die erste Priorität die Bekämpfung der Inflation. So schnell wie möglich müssen wir zur Geldwertstabilität zurückkehren.
(Beifall bei der FDP – Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE]: Warum machen Sie dann das Gegenteil?)
Die Bundesregierung hat dazu bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Eine Maßnahme beispielsweise ist die steuerfreie Inflationsprämie bis zu 3 000 Euro, die einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Tarifpartner Lohnabschlüsse erzielt haben, die eine Lohnpreisspirale unwahrscheinlich machen. Das ist daneben unsere solide Haushaltspolitik; denn die Europäische Zentralbank bekämpft mit ihren Mitteln die Inflation durch den steigenden Zins. Der ist ja nicht nur eine Belastung für die Haushaltspolitik des Bundes. Wenn wir uns die Baukonjunktur anschauen: Was dort passiert, hängt doch insbesondere mit dem sehr schnellen und von vielen unerwarteten Anstieg der Finanzierungskosten zusammen. Selbstverständlich wollen und müssen wir auch über die Reduzierung von Standards und über schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren sprechen.
(Beifall bei Abgeordneten der FDP)
Da gibt es Einvernehmen. Aber insbesondere macht uns Sorge der schnelle, dramatische Anstieg der Zinsen, der viele Projekte jetzt scheinbar nicht rentabel sein lässt. Das ist einer der Preise, die wir zahlen für die alternative Bekämpfung der Inflation durch die Politik der Europäischen Zentralbank.
Welchen Beitrag können wir leisten? Unser Beitrag kann sein, die Kosten der Bekämpfung der Inflation durch die Zinspolitik der Notenbank nicht weiter steigen zu lassen. Würden wir Konjunkturprogramme auf Pump aufsetzen, würde die Bekämpfung der Inflation länger dauern und teurer für unsere Volkswirtschaft sein, und deshalb machen wir dies nicht.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD)
Anderseits ist in unserem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld unsere wirtschaftliche Entwicklung unbefriedigend. Wir gehören beim Wachstum nicht zur Spitzengruppe, aber das muss unser Anspruch sein. Deutschland kann sich in ökonomischer Hinsicht nicht erlauben, auf die Leistungsfeststellung zu verzichten, wie manche das bei den Bundesjugendspielen beabsichtigen.
(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der FDP)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn unser Anspruch ist – und das sollte er sein –, dass wir weiter führend bei den sozialen Absicherungssystemen sind, wenn unser Anspruch ist, dass wir weltweit weiter führend sein wollen bei der ökologischen Verantwortung, wenn wir also soziale und ökologische Projekte vorantreiben wollen, dann geht kein Weg daran vorbei, dass wir unser Land wieder auf den Wachstumspfad zurückführen müssen.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des Abg. Dr. Sebastian Schäfer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Das eine geht nicht ohne das andere. Wir müssen also das wirtschaftliche Fundament stärken, weil nur das verteilt werden kann, was zuvor erwirtschaftet worden ist.
(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: So ist es!)
Dabei unterscheiden wir klar zwischen konjunkturellen Belastungen – ich nenne hier als Stichwort die wirtschaftliche Situation auf den Exportmärkten, insbesondere in China –, den Auswirkungen der Inflationsbekämpfung, etwa den Zusammenhang zwischen Zins und Baukonjunktur, auf der einen Seite und den strukturellen Problemen, die wir schon länger haben, auf der anderen Seite. Wir haben die Probleme in der deutschen Wirtschaft, in unserer Wettbewerbsfähigkeit, nicht erst nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine oder durch die konjunkturelle Schwäche Chinas, sondern wir haben schon längere Zeit strukturelle Probleme, mit denen wir umgehen müssen und mit denen wir umgehen werden.
Die Bundesregierung zum Beispiel hat vorgeschlagen – und der Bundestag hat es beschlossen –, dass wir die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger in der Inflation erhalten. Wir haben deshalb nicht nur die Sozialleistungen an die Inflation angepasst, sondern wir haben mit dem Inflationsausgleichsgesetz auch die Kaufkraft der arbeitenden Bevölkerung erhalten. Eine fünfköpfige Familie mit 55 000 Euro zu versteuerndem Einkommen zahlt in diesem Jahr 800 Euro weniger Steuern als nach dem alten Steuerrecht. Das ist ein Beitrag zum Erhalt der Kaufkraft.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Wir haben in unserem Land inzwischen ein dichtes Geflecht von bürokratischen Regelungen, die nicht nur die Veränderungsprozesse in unserem Land verlangsamen, sondern die auch für die öffentliche Hand wie für die Privaten kostenträchtig sind. Das Bundeskabinett hat deshalb in Meseberg ein Eckpunktepapier beschlossen, mit dem wir einem Bürokratie-Burnout entgegenwirken wollen. Die Vorschläge, die wir dort miteinander verabredet haben, führen zu einem geringeren Erfüllungsaufwand in einer Größenordnung von 2,3 Milliarden Euro jährlich. Allerdings kommen viele bürokratische Hürden auch aus Brüssel. Die Bundesregierung tut, was in ihrer Macht steht, um dort für Mäßigung zu sorgen. Außerordentlich hilfreich wäre aber die Unterstützung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in der Ansprache der Ihrer Partei angehörenden Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen;
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
denn dann müsste die Bundesregierung nicht eigens intervenieren.
Wir haben doch seit Jahren, seit mehr als einem Jahrzehnt, erkennbar Probleme am Arbeitsmarkt. Jetzt ist sichtbar, dass uns Fach- und Arbeitskräfte fehlen. Und diese Koalition hat die Kraft, das Management der Zuwanderung nach Deutschland neu zu ordnen, um diese Bremse für unsere wirtschaftliche Entwicklung zu lösen. Kurz gesagt: Auch unter der Verantwortung einer früheren Bundesregierung haben wir es in Deutschland denjenigen zu lange zu schwer gemacht, zu kommen, die wir dringend im Arbeitsmarkt brauchen,
(Beifall bei Abgeordneten der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Norbert Kleinwächter [AfD])
und zugleich haben wir es viel zu lange denjenigen zu leicht gemacht, zu bleiben, die irregulär nur in unseren Sozialstaat eingewandert sind. Wir müssen das genau umkehren, und das tut diese Bundesregierung.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Lachen des Abg. Dr. Bernd Baumann [AfD] – Thorsten Frei [CDU/CSU]: Echt? Davon sehen wir aber nichts!)
Meine Damen und Herren, wir haben in Meseberg den Entwurf eines Wachstumschancengesetzes beschlossen. Wir setzen damit Anreize für Investitionen und Innovationen. Unter anderem sehen wir eine Investitionsprämie vor, eine gewinnunabhängige steuerliche Investitionszulage für Investitionen, die dem Klimaschutz und der Energieeffizienz dienen. Sie soll 15 Prozent der begünstigten Aufwendungen des Unternehmens betragen. Wir verbessern die Liquidität des Mittelstands, indem wir die Prozentgrenze bei der Verrechnung des Verlustvortrags auf 80 Prozent für vier Jahre anheben. Wir führen verbesserte Abschreibungsbedingungen ein. Wir werden zeitgleich die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter ab dem 1. Oktober wieder einführen. Wir verbessern die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung. Und wir erleichtern den Wohnungsbau durch eine degressive AfA mit 6 Prozent ab Baubeginn – nicht ab Baugenehmigung, sondern ab Baubeginn – am 1. Oktober dieses Jahres. Das sind Entlastungen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, in einer Höhe von rund 7 Milliarden Euro im Jahr – das richtige Zeichen zur richtigen Zeit.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Darüber hinaus hat das Kabinett bereits den Entwurf eines Zukunftsfinanzierungsgesetzes beschlossen. Damit wollen wir den Gründerstandort Deutschland verbessern. Wir stärken die Finanzierungsbedingungen von Start-ups, wir verbessern die Rahmenbedingungen des Fondsstandorts Deutschland, und wir verbessern die Talentgewinnung von jungen Unternehmen und Start-ups, indem wir die Mitarbeiterkapitalbeteiligung endlich praxistauglicher ausgestalten. Denn wir wissen: Neu gegründete Unternehmen sind so etwas wie das ausgelagerte Forschungslabor der deutschen Wirtschaft. Sie sind Hefe im Teig einer Volkswirtschaft, bringen Wachstum und schaffen neue Arbeitsplätze. Deshalb machen wir den Standort Deutschland dafür attraktiver.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Und, meine Damen und Herren, die Bundesregierung beschleunigt Planungs- und Genehmigungsverfahren. Damit haben wir schon große Erfolge erzielt. Der Umbau unserer Energieversorgungsinfrastruktur wäre ohne die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren, wie wir sie auch jetzt vorsehen, nicht in dieser kurzen Zeit gelungen. Unser Ehrgeiz ist: Nicht nur bei den LNG-Terminals, sondern auch darüber hinaus soll das vom Bundeskanzler so genannte Deutschlandtempo der Benchmark werden; denn unser Land hat Know-how, unser Land hat Kapital, unser Land hat das Turnaround-Potenzial in der Wirtschaft. Was viele aber brauchen und worauf sie warten, ist wortwörtlich grünes Licht, und diese Bundesregierung gibt es ihnen.
(Beifall bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD)
Meine Damen und Herren, das zeigt, dass die Bundesregierung handelt, dass das Kabinett Vorschläge unterbreitet. Jetzt lese ich nahezu jeden Tag, dass Sie von der CDU/CSU einen Krisengipfel für die wirtschaftliche Entwicklung fordern. Meine Damen und Herren von der Union, wo Sie noch reden wollen, da handelt diese Regierung bereits.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Lachen des Abg. Dr. Bernd Baumann [AfD])
Auf Ihre Vorstellungen sind wir gespannt. Einer der Höhepunkte in dieser Woche wird ja die Rede des Oppositionsführers sein.
(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wir haben doch gestern schon eine gehabt!)
Wir sind auf Ihre konkreten Vorstellungen gespannt. Beispielsweise gibt es in der steuerpolitischen Diskussion Neues von Ihnen zu hören. Da gibt es Kritik von Herrn Winkel – das ist der Bundesvorsitzende der Jungen Union – an dem Vorschlag, den Spitzensteuersatz zu erhöhen; so hatte sich die Grundsatzkommission der Union mal geäußert. Jetzt lese ich heute Morgen bei dpa, dass Herr Frei sagt, das sei alles gar nicht so gemeint, der Spitzensteuersatz solle gar nicht erhöht werden, man denke gar nicht wie Herr Kühnert in Richtung einer aufkommensneutralen Steuerreform. Das ist ja alles hochinteressant. Wissen Sie, für gewisse Geräusche der Meinungsbildung braucht die Koalition drei Parteien. Das können Sie alleine, intern mit Ihren eigenen Ressourcen.
(Beifall bei der FDP, der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wir sind jedenfalls auf die Auflösung gespannt. Wenn ich das mal nur so grob aufsummiere: Solidaritätszuschlag abschaffen – prinzipiell gute Idee. Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß senken – prinzipiell gute Idee.
(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Hat ja auch die FDP beschlossen!)
Mittelstandsbauch abflachen – prinzipiell sehr gute Idee. Das Ganze soll jetzt aber nicht aufkommensneutral sein, habe ich heute neu gelernt.
(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Na klar! – Zuruf des Abg. Friedrich Merz [CDU/CSU])
Dann reden wir also über Milliarden. Wir reden über 30 Milliarden bis 40 Milliarden Euro. Ich bin absolut neugierig auf das Finanzierungskonzept, nachdem ja schon das CDU-geführte Land Berlin glaubt, dass das Wachstumschancengesetz mit einem Volumen von 7 Milliarden Euro nicht zustimmungsfähig sei. Aber auch auf den Bundeshaushalt hätte das ja Effekte; es würde zu Einnahmeausfällen führen. Ich bin gespannt, wie die gegenfinanziert werden sollen. Ich will dann gerne auch von Ihnen lernen, wo konkret gestrichen werden soll. Vielleicht wird es aber auch wirtschaftliches Wachstum geben, das die Steuerreform finanziert; dieses Argument kenne ich auch.
(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Dunja Kreiser [SPD])
Meine Damen und Herren, ich glaube auch an Selbstfinanzierungseffekte von Steuerreformen. Aber die brauchen erstens Zeit – und wir haben die Schuldenbremse, die keine Steuersenkungen auf Pump erlaubt –,
(Zuruf der Abg. Dr. Silke Launert [CDU/CSU])
und zweitens sollte man die Selbstfinanzierungseffekte nicht überschätzen.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Wer also glaubt, die Abschaffung des Soli, die Einführung eines Stromsteuermindestniveaus und das Abflachen des Mittelstandsbauches würden sich selbst ganz schnell über die Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung finanzieren, der irrt.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Dann wäre Ronald Reagan ein ängstlicher Zauderer im Vergleich zu Friedrich Merz gewesen. Das würde nicht funktionieren.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Im Ernst, meine Damen und Herren: Ich warne vor der Debatte, den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Das wird ja in der CDU/CSU diskutiert.
(Friedrich Merz [CDU/CSU]: Nein!)
– Es wird nicht diskutiert? Was hat dann der Wirtschaftsrat der CDU kritisiert, wenn es gar keine gegensätzlichen Vorstellungen gibt? Da habt ihr intern viel zu klären. Offensichtlich gibt es ja diese Vorstellungen in der Grundsatzkommission der Union.
Ich kann davor nur warnen. Die Einkommensteuer ist für unzählige Betriebe die betriebliche Steuer. Das ist nicht die Steuer von Spitzenmanagern und Fußballprofis, sondern der Spitzensteuersatz ist die betriebliche Steuer, die steuerliche Belastung unseres Mittelstands – von Handwerk und produzierendem Gewerbe, von vielen Freiberuflern, die Eigenkapital aufbauen wollen, die Rücklagen brauchen, die Investitionen tätigen wollen. In der jetzigen fragilen wirtschaftlichen Situation eine Belastung in den Raum zu stellen, verunsichert diejenigen, die wir für die Schaffung von Arbeitsplätzen brauchen und die investieren sollen. In der jetzigen Phase ist Entlastung erforderlich, aber keine auch nur kompensatorische Belastung.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt die Kritik, die Schuldenbremse verhindere notwendige Investitionen. Deshalb: Schauen wir uns die konkreten Zahlen an, die wir mit diesem Haushaltsentwurf vorlegen. Über den gesamten Finanzplanzeitraum bleiben die Investitionen auf einem sehr hohen Niveau stabil. Allein im kommenden Jahr werden 54,2 Milliarden Euro zur Verfügung stehen für die Erneuerung von Schienen und Brücken, für bessere Straßen, ein flächendeckendes Ladesäulennetz für E-Autos, Glasfaserleitungen für schnelles Internet und vieles mehr. Das ist weitaus mehr als vor der Krise. Im Jahr 2019 sah der Bundeshaushalt Investitionen von 38 Milliarden Euro vor. Im Finanzplanungszeitraum werden die Investitionen weiter deutlich ansteigen, bis auf 57,2 Milliarden Euro im Jahr 2027.
Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 steigt im Übrigen auch die Investitionsquote. Also nicht nur die absoluten Zahlen steigen, sondern auch die Investitionsquote steigt von 10 auf 12 Prozent. Das zeigt: Wir sparen nicht bei den Investitionen, sondern wir stärken die Investitionen in die Zukunft dieses Landes.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Übrigens wurde die Schuldenbremse im vergangenen Jahrzehnt übererfüllt. Im vergangenen Jahrzehnt hatten wir ja eine Politik der schwarzen Null. Das war also mehr als nur die Schuldenbremse.
(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Was war das denn für eine Regierung?)
Und gleichzeitig gab es, obwohl es die Reserven gab, sodass Sie noch nicht einmal die Verschuldung der Schuldenbremse ausnutzen mussten, eine so niedrige Investitionsquote.
(Christian Dürr [FDP]: Ja!)
Sie haben nämlich während Ihrer Verantwortungszeit insbesondere Sozialausgaben ausgedehnt, aber haben nicht investiert, weshalb wir die Defizite in der öffentlichen Infrastruktur von Ihnen geerbt haben.
(Beifall bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD)
Die Schuldenbremse ist keine Investitionsbremse. Sie zwingt aber zur Prioritätensetzung, und das gelingt uns besser als Ihnen.
(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Sie weiten doch jetzt die Sozialleistungen aus! Kindergrundsicherung! – Alexander Dobrindt [CDU/CSU]: Bürgergeld!)
Die Investitionsquote steigt gegenüber dem Haushalt, den Sie vor der Krise verantwortet haben, auf 12 Prozent; die Zahlen sind glasklar.
(Sebastian Brehm [CDU/CSU]: Eben nicht!)
Weitere 58 Milliarden Euro mobilisieren wir im Übrigen über den Klima- und Transformationsfonds im nächsten Jahr; die addieren sich noch dazu.
(Zuruf des Abg. Peter Boehringer [AfD])
Im nächsten Jahr stehen also gut 112 Milliarden Euro zur Verfügung. Unsere Herausforderung ist nicht mangelndes Kapital. Unsere Herausforderung ist das Tempo von Planungs- und Genehmigungsverfahren, um aus dem Geld überhaupt Gutes zu machen.
(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Metin Hakverdi [SPD] – Thorsten Frei [CDU/CSU]: Sprechen Sie mal mit den Grünen!)
Mit dem Klima- und Transformationsfonds fördern wir massiv die Erneuerung am Wirtschaftsstandort Deutschland.
(Sebastian Brehm [CDU/CSU]: Da klatscht keiner!)
Mit diesem Fonds stehen in den nächsten Jahren 211 Milliarden Euro für entsprechende Maßnahmen zur Verfügung. Die höchsten Summen entfallen dabei auf die Gebäudesanierung, die Dekarbonisierung der Industrie,
(Beatrix von Storch [AfD]: Wahnsinn!)
unter anderem durch das Instrument der Klimaschutzverträge,
(Beatrix von Storch [AfD]: Wahnsinn!)
die Förderung von klimaneutraler Mobilität
(Beatrix von Storch [AfD]: Wahnsinn!)
sowie der Halbleiterproduktion und dem Aufbau der Wasserstoffindustrie.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abg. Dr. Paula Piechotta [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Wir gestalten die Transformation technologieoffen. Der KTF wird im nächsten Jahr allein 18,9 Milliarden Euro für die Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude aufwenden, für die EEG-Förderung 12,6 Milliarden Euro, für die Weiterentwicklung der Elektromobilität inklusive Ladeinfrastruktur 4,7 Milliarden Euro. Und – wichtig für den Bundeshaushalt –: Der KTF finanziert sich aus den Einnahmen der CO
(Peter Boehringer [AfD]: Das haben Sie doch hundertmilliardenfach gemacht in den letzten Jahren! Ist doch lächerlich! Alles längst erledigt!)
Alle Finanzhilfen sind temporär und auslaufend. Der KTF ist damit ein entscheidendes Instrument, um uns fit für die Zukunft zu machen. Wir schaffen die Grundlagen für Dekarbonisierung und Digitalisierung.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Zuruf der Abg. Beatrix von Storch [AfD])
Aber – ich habe gehört, was Sie gesagt haben, und will das ausdrücklich auch von mir aus ansprechen – das Konsolidierungsgebot für den Bundeshaushalt gilt selbstredend auch für die Nebenhaushalte, die sogenannten Sondervermögen. Übrigens, Alexander Dobrindt: Die ganzen Sondervermögen, die gestern auch von der CDU/CSU kritisiert worden sind,
(Otto Fricke [FDP]: Wer hat’s gemacht?)
sind überwiegend zu CDU/CSU-Regierungszeiten geschaffen worden.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Dr. Klaus Wiener [CDU/CSU]: Das ist doch ein Scherz!)
Ich werde gerne einmal zählen – das schaffe ich jetzt spontan nicht – und vergleichen, wie viele Sondervermögen Theo Waigel von der CSU eingerichtet hat und wie viele dieser Bundesfinanzminister.
(Zuruf des Abg. Christian Haase [CDU/CSU])
Ich sehe das gar nicht als Kritik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Gegenteil: Ich warne davor – ich warne davor! –, das Instrument des sogenannten Sondervermögens – ich weiß auch, dass das in der Regel Schulden sind, aber so ist eben der technische Begriff; ein Euphemismus, klar – per se zu kritisieren. Es ist nicht per se falsch. Sondervermögen dienen vielmehr dazu, in konkreten Politikbereichen überjährige Planungssicherheit zu schaffen.
(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Genau!)
Was ich indes teile, sind die Bedenken hinsichtlich der Anzahl und des Umfangs der Sondervermögen. Wir, diese Regierung, nutzen Sondervermögen für konkrete Zwecke. Das zusammen auch mit der Opposition errichtete Sondervermögen für die Bundeswehr hat einen ganz konkreten Zweck:
(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Wir waren nicht dabei!)
die Ertüchtigung der Bundeswehr, bis wir das 2-Prozent-Ziel im Bundeshaushalt darstellen können,
(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Der Zweck ist sogar noch konkreter!)
weil der Umsteuerungszeitraum sonst zu kurz gewesen wäre.
(Zuruf der Abg. Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE])
Den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der von der früheren Großen Koalition eingerichtet worden ist, nutzen wir jetzt, um nach dem Energiepreisschock des vergangenen Jahres Härtefälle zu finanzieren und die Strom- und Gaspreisbremse darzustellen.
Aber: Hier gibt es jeweils klare und eindeutige Zweckbindungen. Das Sondervermögen für die Bundeswehr wird auslaufen, und auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds unterliegt einer klaren Zweckbindung bis Mitte 2024. Man kann über unterschiedliche politische Maßnahmen nachdenken, zum Beispiel einen Industriestrompreis. Eines ist aber klar: Eine Zweckänderung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds wäre nach meiner Auffassung verfassungsrechtlich nicht zulässig. Wer also dieses oder jenes finanzieren will, kann gerne eine öffentliche Diskussion über Finanzierungsmöglichkeiten führen. Eine neuerliche Aufhebung der Schuldenbremse, um den gesetzlichen Zweck des Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu verändern, wird jedenfalls kein Mittel der Wahl der Bundesregierung sein können, weil das Grundgesetz davorsteht.
(Beifall bei der FDP – Alexander Dobrindt [CDU/CSU]: Wir halten mal fest, dass es von der SPD und von den Grünen keinen Applaus gibt!)
Wir werden die Zahl der Sonderinstrumente, also der Sondervermögen, in den nächsten Jahren reduzieren.
(Peter Boehringer [AfD]: Aber erst nach Ihrer Regierungszeit!)
Bereits mit dem Bundeshaushaltsentwurf 2024 schlagen wir Ihnen ganz konkret vor, Sondervermögen, die nicht mehr benötigt werden, zu schließen. Die Zahl geht also zurück. Nicht nur hinsichtlich der quantitativen Auswirkungen auf den Haushalt, sondern auch hinsichtlich der qualitativen Dimension der Haushaltspolitik arbeiten wir uns schrittweise voran.
Einen Satz will ich zu den Energiepreisen sagen, weil ich gerade im Zusammenhang mit dem WSF das Stichwort „Industriestrompreis“ genannt habe. Die Bundesregierung insgesamt ist sich vollkommen darüber im Klaren, dass die Energiepreise ein enormer Standortnachteil, vor allen Dingen für die energieintensiven Betriebe, sein könnten.
(Zuruf von der CDU/CSU: Sind!)
Darüber herrscht Einvernehmen innerhalb der Bundesregierung. Aber wir haben es auch mit einer besonderen Situation zu tun. Unsere Situation ist doch, dass eine frühere Bundesregierung ausgestiegen ist aus Kohle und Kernkraft,
(Leif-Erik Holm [AfD]: Mit der FDP in der Regierung!)
und sie hat festgehalten an Pipelineimport von Gas aus Russland, obwohl es andere Ideen gab. Das heißt, die Entscheidungen für den Ausstieg aus Kohle – unstrittig – und Kernkraft – auf lange Sicht ebenfalls unstrittig – haben Sie getroffen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Ihnen und der aktuellen Bundesregierung und der sie tragenden Koalitionsfraktionen: Wir reden nicht nur, wie Sie, über den Ausstieg, sondern wir sorgen für den Einstieg anderswo
(Zuruf von der CDU/CSU: Wo denn?)
und machen da Tempo. Das ist der Unterschied.
(Beifall bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD)
Denn bei aller Diskussion über eine Brücke darf man eines nicht verkennen: Das Kernproblem ist die physikalische Verfügbarkeit von grundlastfähiger Energie.
(Dr. Klaus Wiener [CDU/CSU]: Genau!)
So sind meine ordnungspolitischen Bedenken: Wenn man für einige wenige, finanziert wie auch immer, den Strompreis heruntersubventioniert, dann werden die auch weiter zu diesem günstigen Preis Strom verbrauchen. Bei knappem Angebot wird für alle anderen, auch für Handwerk, Mittelstand, auch für die Rentnerin und den BAföG-Empfänger, der Strompreis in der Tendenz steigen. Deshalb geht kein Weg daran vorbei: Das Angebot an Energieerzeugung muss ausgebaut werden:
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Dr. Silke Launert [CDU/CSU]: Das sagt der Richtige! Wer hat die Verknappung mitgemacht?)
bei den Erneuerbaren, bei Gaskraftwerken, bei anderen.
(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Und jetzt?)
Auf dem Weg dahin müssen wir Instrumente finden, die in den Rahmen der Schuldenbremse passen, die keine Fehlanreize geben, auf Effizienzgewinne zu verzichten, und die keine Wettbewerbsverzerrung innerhalb unserer Volkswirtschaft bringen. Und das wird der Bundesregierung gelingen.
(Lachen bei Abgeordneten der AfD)
Meine Damen und Herren, neben der Priorisierung von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum trägt dieser Haushaltsentwurf auch den geopolitischen und geoökonomischen Realitäten Rechnung. Der Ukraine zu helfen, das ist nicht nur ein Anliegen der Mitmenschlichkeit und Solidarität, es ist in unserem ureigensten staatspolitischen Interesse. Bei meinem Besuch in Kiew habe ich mich ein weiteres Mal überzeugen können: In der Ukraine wird nicht nur das Recht auf Selbstbestimmung dieses Landes verteidigt; in der Ukraine wird gekämpft um die Friedens- und Freiheitsordnung in Europa insgesamt.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN] und des Abg. Matthias Hauer [CDU/CSU])
Deshalb werden wir die Ukraine weiter unterstützen. In der Haushaltsplanung der nächsten Jahre sind weitere Hilfen – Ertüchtigungshilfe, aber auch im zivilen Bereich – fest eingeplant. Niemand soll sich täuschen. Bei dieser Schicksalsfrage wird die Bundesrepublik Deutschland einen langen Atem haben.
Auch unsere eigene Wehrfähigkeit und unsere Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung muss verbessert werden. Dieser Regierungsentwurf sieht 51,8 Milliarden Euro für den Einzelplan 14 vor. Das sind 1,7 Milliarden Euro mehr als zuvor, weil wir schon im Einzelplan 14 die Tarifsteigerungen verbuchen, die wir für andere Häuser im Einzelplan 60 darstellen. Summiert man die geplanten Ausgaben aus dem Bundeshaushalt und dem Sonderprogramm für die Bundeswehr im Grundgesetz, so erreichen wir ab dem kommenden Jahr die NATO-Quote für Verteidigungsausgaben in Höhe von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Zusage der Bundesregierung ist: Dies werden wir in den nächsten Jahren auch über die Zeit des Sondervermögens im Grundgesetz hinaus fortsetzen. Denn die Zeiten haben sich gewendet: von der Zeit der Friedensdividende hin zur Zeit der Investitionen in Sicherheit, Freiheit und Frieden.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Auch im Bereich der Innenpolitik sind Freiheit und Sicherheit für uns prioritär. Hier leistet jedes Ressort seinen Beitrag. Ich will jetzt nur für das BMF darauf hinweisen, dass wir an der Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche arbeiten. Ein Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ist im Projektstatus, und wir planen, Ihnen in der allernächsten Zeit die notwendige Gesetzgebung vorzuschlagen. Damit sollen die wichtigsten Kompetenzen für Geldwäschebekämpfung und Sanktionsdurchsetzung gebündelt werden. Machen wir es ganz klar: Folgenlose Finanzkriminalität schadet unserer Wirtschaft und untergräbt das Vertrauen in den Rechtsstaat, während die Gegner der freiheitlichen Ordnung davon profitieren.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Matthias Hauer [CDU/CSU]: Ein Jahr lang ist nichts passiert!)
Meine Damen und Herren, dieser Haushalt schließt – damit komme ich zum Blick nach vorn – die finanzpolitische Zeitenwende nicht ab. Sie nimmt eher Fahrt auf. Und das ist umso wichtiger, als wir im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 noch einen jährlichen Handlungsbedarf von rund 5 Milliarden Euro im Jahr haben – Stand jetzt. Das heißt, in jedem der nächsten Jahre, 2025 bis 2027, müssen wir über den Entwurf der Finanzplanung hinaus eine Lücke von 5 Milliarden Euro zwischen erwarteten Einnahmen und geplanten Ausgaben schließen. Das ist übrigens kein Novum; das gab es in der Vergangenheit genauso. Beispielsweise hat Wolfgang Schäuble 2011 bis 2013 einen Handlungsbedarf von 30 Milliarden Euro eingeplant, der übrigens damals aber auch erwirtschaftet worden ist.
(Bettina Hagedorn [SPD]: 8 Milliarden bei der Bundeswehr!)
Den Ehrgeiz haben wir genauso.
Schauen wir über den aktuellen Finanzplanungszeitraum hinaus, liebe Kolleginnen und Kollegen: Dann wird unser Haushalten noch anspruchsvoller werden im Vergleich zu den Herausforderungen, die wir jetzt schon in den öffentlichen Debatten zu bestehen haben. 2028 beginnt die Tilgung der krisenbedingten zusätzlichen Kreditaufnahmen aus den Coronajahren 2020 bis 2022. Allein das werden im Jahr voraussichtlich 12 Milliarden Euro sein. Die Mittel des „Sondervermögens Bundeswehr“ werden im Finanzplanungszeitraum mutmaßlich vollständig ausgeschöpft sein. Ab 2028 bedarf es da erheblicher Mittel im Kernhaushalt, um die 2 Prozent Verteidigungsausgaben darstellen zu können. Wir reden über einen zweistelligen Milliardeneurobetrag.
(Friedrich Merz [CDU/CSU]: 30 Milliarden!)
Ab dem Jahr 2031 ist auch die Tilgung der Kredite des Wirtschaftsstabilisierungsfonds Energie vorgesehen. Und das führt dann ebenfalls zu großem Handlungsbedarf im Milliardenbereich. Das ist jetzt in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht sichtbar, weil sie bis 2027 reicht.
Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, hinter der Horizontlinie – für uns noch nicht sichtbar – kommt ein Eisberg, um nicht zu sagen ein Eisbergfeld. Und wir stehen in der Verantwortung, nicht zu warten, bis der Eisberg vom Horizont uns genau vor den Bug gekommen ist, sondern wir müssen jetzt den Kurs ändern; denn der Eisberg wird seinen Kurs nicht ändern. Wir sind es, die unseren haushaltspolitischen Kurs ändern, und dazu leistet dieser Haushalt 2024 einen wichtigen Beitrag.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Dr. Christina Baum [AfD]: Sie sind doch der Eisberg!)
Ich sage ganz klar: keine strukturellen Mehrausgaben ohne Gegenfinanzierung. Für jeden zusätzlichen Euro, der ausgegeben werden soll, empfehle ich Ihnen, an anderer Stelle einen Einsparvorschlag zu machen. Unser Land insgesamt hat kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem.
(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: So ist es! Genau!)
Knapp ist in diesem Haushalt nur eins, liebe Kolleginnen und Kollegen, und zwar der Gestaltungsspielraum. Zwei Drittel des Haushalts werden 2024 für Personal- und Sozialausgaben und Zinskosten gebunden sein. Nach der quantitativen Konsolidierung – Schuldenbremse einhalten, im Kernhaushalt die Finanzlage abbilden –, muss die qualitative Konsolidierung fortgesetzt werden. Da geht es darum, unsere Sozialversicherungssysteme zu stabilisieren, ohne immer weitere zusätzliche Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Einen Beitrag dazu leisten werden der Bundesarbeits- und -sozialminister und ich mit dem Vorschlag eines nächsten Rentenpakets, das eine kapitalgedeckte Säule in die gesetzliche Rentenversicherung einfügt, um die Beitragssätze nicht weiter steigen zu lassen.
(Beifall bei der FDP – Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Keine gute Idee, Herr Minister! Lassen Sie das lieber! Das bringt gar nichts!)
– Nein, wir werden das nicht lassen. – Denn die Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Angestelltenverhältnis haben alle ihre Versorgungskassen, und die legen am Kapitalmarkt an. Was für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gut ist, das kann für die Rentnerinnen und Rentner insgesamt nicht falsch sein.
(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Dagmar Andres [SPD] – Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das erläutere ich Ihnen gerne mal!)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch insgesamt ist unsere Sozialquote im historischen Vergleich auf einem sehr hohen Niveau. Unser Sozialstaat kann nicht weiter wachsen. Wir werden dafür sorgen müssen, die Entwicklung unseres Sozialstaates zu begrenzen, aber nicht durch Streichung, nicht durch die Einschränkung von Leistung, sondern dadurch, dass wir die Migration in unserem Land steuern
(Lachen bei der AfD)
und dass wir dafür sorgen, dass diejenigen in Arbeit kommen, die arbeiten können, aber es gegenwärtig nicht tun.
(Zuruf des Abg. Norbert Kleinwächter [AfD])
Diesem Gedanken folgt unsere neue Kindergrundsicherung mit einer klaren Orientierung darauf, Kinderarmut zu überwinden, zugleich aber die Anreize für die Arbeitsaufnahme zu erhöhen. Diesem Ziel folgt das Bürgergeld, das verstärkt qualifiziert und das langfristig in den Lebensunterhalt sichernde Arbeitsplätze vermittelt statt in Hilfstätigkeiten. Aber wir werden in diesem Jahr auch prüfen, ob Lohnabstand und Erwerbsanreize in unserem Land sich angesichts der vielen Sozialreformen der vergangenen Jahre positiv entwickelt haben. Wir haben im Koalitionsvertrag eine entsprechende Evaluation verabredet, und wir werden nötigenfalls die erforderlichen Konsequenzen ziehen.
(Beifall bei der FDP)
Denn es ist nicht nur ein Gebot des sorgsamen Umgangs mit den Staatsfinanzen. Meine Damen und Herren, Arbeit ist viel mehr. Arbeit ist für die Menschen doch nicht nur die Quelle des Lebensunterhalts.
(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: So ist es! Genau!)
Arbeit strukturiert den Alltag. Arbeit gibt das Gefühl, dazuzugehören. Und deshalb muss das Ziel der Sozialpolitik nicht sein, die Etatansätze zu erhöhen, sondern die praktischen Lebenschancen der Menschen zu verbessern, indem ihnen Teilhabe ermöglicht wird.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich bin überzeugt: Der Haushalt 2024 ist ein Haushalt mit Geld und Verstand, ein Haushalt mit Mut statt Leichtsinn, ein Haushalt mit weniger Schulden und mehr Chancen, ein kluger Haushalt der Veränderung. All diese Entscheidungen haben Überzeugungskraft gekostet, aber ich bin mir sicher, sie werden wirken.
Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/7556757 |
| Wahlperiode | 20 |
| Sitzung | 117 |
| Tagesordnungspunkt | Einbringung Haushaltsgesetz 2024, Finanzplan des Bundes 2023 bis 2027 |