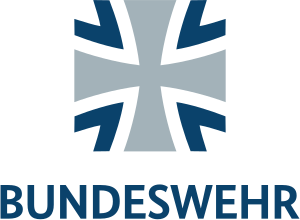Wilfried LorenzCDU/CSU - Gedenken an die Opfer des Völkermordes in Ruanda
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda und fast 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist es berechtigt, die Frage zu stellen: Hat die internationale Völkergemeinschaft aus der Geschichte gelernt?
Wir gedenken heute des grausamsten Völkermords auf dem afrikanischen Kontinent. Gedenken heißt innehalten, erinnern, aber vor allem Wege in eine bessere Zukunft finden und diese dann auch zu gehen. Erinnern an den ruandischen Völkermord heißt gleichzeitig, sich an die Verantwortung der internationalen Staatengemeinschaft für Afrika und andere Regionen in der Welt zu erinnern. Ich möchte an dieser Stelle die Frage wiederholen: Haben wir aus der Geschichte wirklich ausreichend gelernt?
Wir erinnern uns heute an die unfassbare Gewalt in Ruanda, die die internationale Staatengemeinschaft nicht beenden konnte. Wir erinnern uns heute an Blutbäder und an unaussprechliche Grausamkeiten, die uns mit Abscheu und Entsetzen erfüllen. Gerade deshalb ist es mir persönlich ein wichtiges Anliegen, heute hier zu sprechen, und zwar als Bürger eines Staates, der sich für ein friedliches Miteinander in der Welt einsetzt und Grundrechte wie Würde und körperliche Unversehrtheit seiner Bürgerinnen und Bürger schützt, und als Kind einer Zeit, in der die unmittelbaren Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs in Deutschland noch hautnah zu spüren waren.
Die Regierungskoalition und die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen haben gemeinsam einen Antrag formuliert, in dem sie das in Ruanda Geschehene verurteilen und die unsäglichen Gräueltaten gerade an Frauen und Kindern ächten. Das Bedauern über – ich zitiere aus dem Antrag – „die wenig entschiedene Rolle der internationalen Gemeinschaft, die trotz vielfältiger Informationen über das mörderische Handeln vor Ort nicht ausreichend versucht hat, die Gräuel zu beenden“, kommt darin deutlich zum Ausdruck. Gleichzeitig werden wir mit dem Antrag Wege aufzeigen, um den Versöhnungsprozess und den Aufbau demokratischer und rechtsstaatlicher Strukturen in Ruanda zu unterstützen.
Der Völkermord in Ruanda entstand aus einem Jahrzehnte schwelenden Konflikt zwischen Volksgruppen der Hutu und der Tutsi. Erinnern wir uns kurz. April bis Juni 1994: 800 000 Tutsis und gemäßigte Hutus in nur 100 Tagen ermordet, systematisch hingemetzelt auf das Grausamste mit Macheten, Äxten und Knüppeln; Morde, Köpfungen und Vergewaltigungen als Normalität. Das ist die schreckliche Bilanz des Völkermordes in Ruanda, und dennoch: Die ruandische Gesellschaft ist dabei, die Geschichte aufzuarbeiten, und hat bereits eine große Wegstrecke hin zu einem inneren Frieden zurückgelegt. In unserem Antrag würdigen wir ausdrücklich den Beitrag der Regierung Ruandas zur gesamtgesellschaftlichen Versöhnung. Sie, diese Regierung, diese Menschen dort, haben die Lehren aus dem nicht verhinderten Genozid gezogen. Sie verfolgen eine auf Schaffung demokratischer Strukturen gerichtete Reformagenda und engagieren sich für ein globales Bewusstsein, das die Früherkennung aufkommender Konflikte und die Prävention fördert. Hier wurde aus der Geschichte gelernt.
Systematische Eliminierungen ethnischer Volksgruppen, Massaker und Völkerrechtsverletzungen gab es aber auch in der europäischen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, sogar noch in der Zeit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, als wir alle von der Friedensdividende gesprochen haben. Ich denke zum Beispiel an Srebrenica. Im Fall Ruanda blieb die Völkergemeinschaft zunächst untätig. Es gab keinen Aufschrei der Empörung, nur zögerlich wurde entschieden, das Blauhelmkontingent aufzustocken, eine UN-Resolution gab es erst im späteren Verlauf der Krise, als das Töten schon im vollen Gange war.
Was lernen wir aus diesen Ereignissen? Welche Lehren ziehen wir daraus?
Erstens. Durch Nichthandeln kann sich die Völkergemeinschaft ebenso schuldig machen wie durch Handeln.
Zweitens. Deutschland muss seiner Rolle als politisch und wirtschaftlich starke Kraft in der Völkergemeinschaft gerecht werden. Dies haben unser Bundespräsident, Herr Gauck, und die Bundesverteidigungsministerin, Frau Dr. von der Leyen, in Grundsatzreden sehr deutlich formuliert.
Daher ist das Engagement Deutschlands in Zentralafrika und Somalia nur konsequent. Im internationalen Miteinander können Wegschauen, Zögern und Untätigbleiben die furchtbaren Konsequenzen haben, auf die wir in diesem Moment, in dieser Stunde schauen.
Der Völkergemeinschaft müssen Möglichkeiten zugestanden werden, schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstöße gegen das Völkerrecht zu unterbinden; RtoP ist hier gerade angesprochen worden. Dieses Eingreifen muss frühzeitig geschehen, bevor Morde, Folter, Verstümmelungen oder Massenvergewaltigungen unvorstellbare Ausmaße annehmen können – wie in Ruanda –, auch wenn sich die Völkergemeinschaft dabei ohne Mandat – wie im Kosovo-Krieg – anfangs in einer völkerrechtlichen Grauzone bewegt.
Solche Grauzonen resultierten bisher aus einem Vetoverhalten weniger Staaten im UN-Sicherheitsrat, das ungeachtet menschlichen Leidens machtpolitischen Interessen diente. Wir haben es gerade wieder erleben müssen, dass eine Verletzung des Völkerrechts nicht vom UN-Sicherheitsrat verurteilt werden konnte. Alle fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates stehen in der besonderen Pflicht, bewusst mit ihrem Vetorecht umzugehen. Sie sind aufgerufen, eine Kultur der Zusammenarbeit zu pflegen; denn wir befinden uns im 21. Jahrhundert, in dem die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren gelten muss.
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Deutschland trägt seiner Verantwortung mit dem Konzept der vernetzten Sicherheit Rechnung. Wir betreiben kein Säbelrasseln, sondern vernetzen außen-, entwicklungs- und sicherheitspolitische Kompetenz, um die Ursachen von Konflikten frühzeitig erkennen und diese eindämmen zu können.
Die Friedensdenkschrift des Rates der Evangelischen Kirche aus dem Jahr 2007 hat den Titel: „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“. Ja, wir müssen für Frieden sorgen. Militärbischof Rink verweist in einem Interview zu Recht darauf, dass militärische Einsätze nur die Ultima Ratio sein können. Entwicklungshelfer wollen wegen der Lage vor Ort zurzeit nicht mehr in die Zentralafrikanische Republik gehen. Vor diesem Hintergrund stellt sich Bischof Rink die Frage, „ob die internationale Gemeinschaft zusieht, wenn das Land im Chaos versinkt, Menschen erschossen werden oder verhungern, oder ob, weil alle anderen Möglichkeiten nicht mehr greifen, unter Umständen ein Einsatz der Bundeswehr mit entsprechendem Mandat – sagen wir: als Schlichtungshilfe – dazu beiträgt, wieder ein rechtsstaatliches Leben herzustellen.“
Meine tiefste Überzeugung ist, dass Deutschland die Verpflichtung hat, Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen anderen Staaten helfen, Sicherheit zu schaffen. Das ist die Grundlage für Frieden, Freiheit und wirtschaftlichen Wohlstand. Das ist auch eine moralische Pflicht, gerade vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Unsere Sicherheit, auf der wir unseren Wohlstand aufgebaut haben, haben wir jahrzehntelang durch andere Länder garantiert bekommen. Das sollten wir Deutsche nicht vergessen.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Lassen Sie mich eine sehr persönliche Anmerkung machen. Ich habe als Kind 1949 die Berliner Blockade erlebt und war glücklich und froh, eines dieser Essenspakete, die vom Himmel geworfen wurden, aufzufangen. Ich habe mich damals darüber gefreut, dass ich es bekommen habe, aber auch darüber, dass ich meinen Hunger zumindest teilweise stillen konnte. Dabei ist anzumerken, dass die Menschen in dieser Stadt nur überlebt haben, weil sie von ehemaligen Kriegsgegnern nicht im Stich gelassen worden sind. Den Ausdruck „nicht im Stich lassen“ haben wir heute in der Diskussion schon mehrfach gehört. Daraus entstanden Freundschaften, Freundschaften über Jahrzehnte hinweg, Freundschaften zwischen Menschen, Freundschaften von Land zu Land und Freundschaften, die den Frieden in Europa gedeihen ließen.
Lassen Sie mich zum Schluss – meine Redezeit ist abgelaufen – ein afrikanisches Sprichwort zitieren: „Siehst du Unrecht und Böses und sprichst nicht dagegen, dann wirst du sein Opfer.“ Mein Fazit aus dieser Diskussion ist: Völkermord darf sich nicht wiederholen, heute nicht, morgen nicht, nirgendwo. Dieser Verantwortung müssen wir uns stellen, jetzt, jederzeit und überall.
Ich bedanke mich.
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN)
Das war, Herr Kollege Lorenz, Ihre erste Rede im Deutschen Bundestag, zu der ich Ihnen herzlich gratulieren möchte.
(Beifall)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/3274862 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 27 |
| Tagesordnungspunkt | Gedenken an die Opfer des Völkermordes in Ruanda |