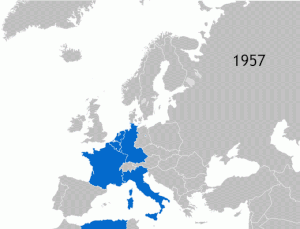Thomas JarzombekCDU/CSU - Speicherpflicht und -frist für Verkehrsdaten
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren!
So schreibt es der cnetz e. V. in seiner Präambel. Das ist nicht nur meine Leitlinie als internetpolitischer Sprecher meiner Fraktion, sondern die Leitlinie vieler, die in der Vergangenheit beim Thema Vorratsdatenspeicherung durchaus eine sehr kritische Position hatten. Eines ist für uns immer klar: Freie Wesen werden sich nur dann so verhalten, dass andere ebenfalls frei sein können, wenn sie damit konfrontiert werden können, Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen. Ein Internet oder Kommunikationsräume, in denen man vollkommen folgenlos auch schwerste Straftaten verüben kann, kann niemals das Ziel der Politik dieses Hauses sein.
Insofern haben wir sehr mit der Frage gerungen, wie eine Vorratsdatenspeicherung, Speicherpflichten und Höchstspeicherfristen tatsächlich ausgestaltet werden können. Ich muss zugeben, dass ich selber zu den Kritikern gehörte, die sagten: Die im europäischen Rahmen vorgesehene Speicherfrist von 24 Monaten, das ungeklärte Verfahren der Datensicherung und der Zugriff in einer relativ großen Breite – das kann, wenn man alle Länder der Europäischen Union betrachtet, keine kluge Politik sein.
Ich glaube aber, dass wir bei dem, was hier heute vorgelegt worden ist, einen ganz anderen Weg gegangen sind und dass wir auch aus dem gelernt haben, was uns zwei Verfassungsgerichte vorgegeben haben. Was die Verfassungsmäßigkeit betrifft, verweise ich an dieser Stelle auf das, was Günter Krings gesagt hat. Ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen.
Es geht mir insbesondere um die Frage der Verhältnismäßigkeit. In dem Entwurf, der uns heute vorliegt, sind Speicherfristen von zehn Wochen für Telefonate und SMS-Nachrichten und von vier Wochen für Standortdaten vorgesehen. Diese Unterscheidung im Gesetz angesichts der höheren Sensibilität von Standortdaten ist ein kluger Gedanke gewesen.
Ich glaube, dass die Nutzung dieses Instruments insbesondere vor dem Hintergrund gerechtfertigt ist, dass es hier – anders, als es manchmal suggeriert wurde – nicht um Abmahnungen im Zusammenhang mit dem Download von Musikdateien geht, sondern nur um allerschwerste Straftaten, die im Gesetz auch ausdrücklich definiert sind; das muss man ganz klar sagen.
(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: So ist das!)
Dass man im Falle eines Gewaltverbrechens – jemand wurde in einem Waldstück vergewaltigt und umgebracht; solche schrecklichen Fälle – über eine Funkzellenabfrage nachvollziehen kann, welche Menschen sich im Umfeld aufgehalten haben, wird die Straftat im Zweifelsfall nicht verhindern; aber es ist für die Aufklärung von großem Wert.
Ich glaube, es ist ein wichtiges Instrument, das in vielerlei Hinsicht verhältnismäßig ist. Das wird deutlich, wenn man sich mit der Frage beschäftigt: Wird eigentlich in die Kommunikation hineingeschaut? Mir persönlich ist wichtig, dass zwar aufgezeichnet werden soll, wer wen angerufen hat und wer wem eine SMS geschickt hat, aber nicht, was gesprochen wurde oder was in der SMS stand. Es werden eben keine WhatsApp-, keine Threema- und keine sonstigen Messengernachrichten gespeichert.
Es gibt natürlich die Sorge: Wo wird uns das, was wir heute machen, einmal hinführen? Deshalb ist es sehr verhältnismäßig, wenn wir eben nicht in ein expansives Gesetzgebungsverfahren einsteigen, das auf die Messengerdienste und auf Kommunikationsformen der Zukunft setzt.
Zu den Internetseiten. Man muss vielleicht noch einmal genauer erklären, was hier tatsächlich gespeichert wird. Das Wort „Verbindungsdaten“ bringt einen eigentlich auf eine falsche Spur; denn so entsteht der Eindruck, dass die Daten jeder Verbindung im Internet abgespeichert werden. Das ist vielleicht bei Google der Fall, aber das gilt nicht für dieses Gesetz. Das Einzige, was gespeichert wird, ist die Adresse, mit der Sie selbst im Internet für 24 Stunden bekannt sind. Es handelt sich also um eine Information in 24 Stunden, zumindest im Regelfall.
Um darauf zu schließen, auf welchen Servern man gewesen ist oder mit wem man kommuniziert hat, braucht man das, was in der IT-Branche eine „Zwei-Faktor- Authentifizierung“ genannt wird: Sie brauchen eine Gegenseite. Nur so kann beispielsweise festgehalten werden, auf welchem Server Nachrichten ausgetauscht wurden bzw. wann welche IP-Adresse dort online gewesen ist. Man kann also allein mit den Daten, die der Staat erhebt, nichts, aber auch gar nichts anfangen, sondern man braucht die Daten der Gegenseite.
Ich glaube, uns liegt ein sehr ausgewogener Gesetzentwurf vor. Viele aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion – ich sehe, dass Frau Schwarzer hier sitzt, von der ich weiß, dass sie durchaus einen kritischen Blick auf die Dinge hat –, aber auch darüber hinaus im cnetz und in anderen Organisationen, die sehr kritisch gewesen sind, sagen nun: Damit können wir leben. Das ist ein vernünftiger Weg, der hier gegangen wird. – Ich persönlich sage ausdrücklich: Das ist ein guter Gesetzentwurf, der viel hilft und wenig schadet.
Schauen wir uns an, wie mit den Themen Anonymität im Internet oder Datensicherheit im Internet umgegangen wird. Häufig werden wir mit dem Argument konfrontiert: Der Staat muss bei diesen Themen besondere Sensibilität zeigen; denn es kann sich keiner sozusagen aus den Fängen des Staates befreien, von dem Gesetz sind nun einmal alle betroffen. – Aber ein Blick auf Unternehmen wie Facebook mit dem angeschlossenen Dienst WhatsApp genügt, um festzustellen: Das ist nur ein theoretischer Gedanke, dass die Menschen heute noch eine Wahl haben, mitzumachen oder nicht. Reden Sie doch einmal mit jungen Menschen, die in der Schule oder im Studium sind und für die solche Dienste wie Facebook und WhatsApp schlicht und ergreifend Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bedeuten. Sie haben de facto keine Möglichkeit, sich dessen zu entziehen, indem sie möglicherweise datenschutzsensiblere Plattformen wählen.
Wir sollten in der weiteren Debatte unser Augenmerk ganz klar darauf richten, wie bei solchen Plattformen, die eine so große Bedeutung haben, dass eine gesellschaftliche Teilhabe für bestimmte Bevölkerungsteile ohne sie kaum noch denkbar ist, mit den viel sensibleren Standort-, Kommunikations- und Inhaltedaten umgegangen wird.
Vielen Dank, meine Damen und Herren.
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/5233673 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 110 |
| Tagesordnungspunkt | Speicherpflicht und -frist für Verkehrsdaten |