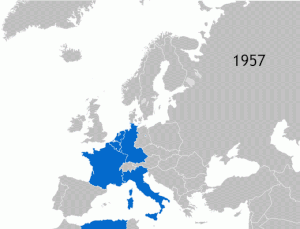Christoph BergnerCDU/CSU - Berichte zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer die Broschüre-Ausgabe des 18. Berichts zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik durchblättert, findet sehr viele schöne, ansprechende und sympathieweckende Fotos. Diese angenehmen Bilder dürfen uns allerdings nicht – das zeigt die bisherige Debatte – darüber hinwegtäuschen, dass sich die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik im Moment in einer Welt bewähren muss, die aus den Fugen geraten ist. Unsere Aufgabe als Parlamentarier besteht ganz wesentlich darin, die Arbeit der Mittlerorganisationen, die Arbeit unserer Auslandsvertretungen mit Kulturpartnern und anderen in den Kontext der bestehenden Konflikte zu rücken und die Lösungsansätze, die dabei gefunden werden, zu unterstützen. Das ist eine Aufgabe, die aus meiner Sicht sehr viel anspruchsvoller ist, als es auf den ersten Blick scheint. Gelegentlich ist die politische Analyse leichter als die Analyse der kulturellen und geistigen Hintergründe von Konfliktsituationen.
Ich will deshalb an zwei aktuellen Stichworten versuchen, zu demonstrieren, was ich damit meine. Die Stichworte sind: Ukraine-Krise und Flüchtlingsfrage – Stichworte, die von Kolleginnen und Kollegen schon angesprochen wurden.
Wenn ich „Ukraine-Krise“ sage, meine ich sehr viel mehr. Der 18. Bericht betont zu Recht, Frau Tank, den Schwerpunkt der Östlichen Partnerschaft in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik; denn es geht um den Wunsch der osteuropäischen und südkaukasischen Länder, besser: Gesellschaften, sich an europäischen Leitbildern zu orientieren – ein Wunsch, der in einen Kontrast, einen Gegensatz zu den politischen Leitbildern Russlands geraten ist. Es ist an dieser Stelle wichtig, sich klarzumachen, dass hinter den politischen Leitbildern Russlands auch geistig-kulturelle Vorstellungen stehen. Ich erinnere an die Schriften von Alexander Dugin, der die eurasische Idee pflegt und dies mit einem derartigen Sendungsbewusstsein vertritt, dass die Wirkung bis zu Marine Le Pen nach Frankreich reicht. Diese Dimensionen müssen wir im Blick haben, wenn wir Östliche Partnerschaft mit den Mitteln der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik fördern und unterstützen wollen. Insofern ist es richtig, dass die Kulturzusammenarbeit aus den Sanktionsmaßnahmen der EU ausdrücklich ausgenommen ist. Mit der gemeinsamen Pflege von Strawinsky oder Puschkin bis hin zu deutschen Autoren und deutscher Literatur schaffen wir gewissermaßen ein Gegengewicht zu trennenden Ideologien und trennenden Ansätzen und sorgen dafür, dass dieses Gegengewicht Raum erhält.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD und der Abg. Claudia Roth (Augsburg) [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Es ist richtig, dass wir einen Sondertitel – er ist schon erwähnt worden – zur Pflege zivilgesellschaftlicher Kontakte im Rahmen der Östlichen Partnerschaft haben. Auch das ist ein ganz wertvolles Instrument. Wir haben uns im Rahmen der Berichterstattung im Unterausschuss darüber informieren lassen. Ich will aber darauf hinweisen, dass es Disparitäten gibt, die bei diesem Aufgabenfeld durchaus problematisch sind. 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gibt es in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik nach wie vor Disparitäten zwischen Ost und West. Ich könnte mehrere Zahlen nennen, will aber beispielhaft nur die Zahl der Goethe-Institute nennen: Während es in Frankreich und Italien je sieben Goethe-Institute gibt, gibt es in Polen zwei und in der Tschechischen Republik nur ein Goethe-Institut. Wenn wir die Zahl der ins Ausland entsandten Lehrer miteinander vergleichen, kommen wir zu einer ähnlichen Betrachtung. Wenn wir uns also mit dem Thema der Östlichen Partnerschaft in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik befassen, das ich für außerordentlich wichtig halte und das im 18. Bericht auch ausdrücklich hervorgehoben wird, dann müssen uns die bestehenden Disparitäten beunruhigen.
Ich komme zum zweiten Punkt, der Flüchtlings- bzw. Migrationskrise. Hierzu ist schon viel gesagt worden. Ich fände es richtig, wenn es sich bestätigen sollte, dass von den zusätzlichen Mitteln, die für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden, ein bestimmter Anteil für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik reserviert wird. Ich halte es für einen außerordentlich wichtigen Beitrag, nicht allein bei den unmittelbaren, „harten“ humanitären Maßnahmen anzusetzen, sondern durchaus auch Maßnahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik mit im Blick zu haben.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Die Flüchtlingslager sind schon angesprochen worden. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine verlorene Generation entsteht. Das zu verhindern, ist richtig und sollte von uns unterstützt werden. Ich will aber in diesem Kontext auf einen anderen Punkt hinweisen, der mir Sorge macht – ich erkenne hier ein Bewährungsfeld der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik –: Wir wollen, dass die Flüchtlingsaufnahme europäisch gelöst wird; das heißt, wir wollen gemeinsame Verfahren und eine faire Verteilung der Aufgenommenen. Wir kennen die Probleme, auf die wir dabei gestoßen sind und die im Moment durch Mehrheitsentscheidung im JI-Rat vorübergehend gelöst scheinen. Die Weigerung, Flüchtlinge aufzunehmen, interpretieren wir im Moment mit einer gewissen Berechtigung als einen Mangel an Solidarität. Aber ich glaube, sich allein darauf zu berufen, greift zu kurz. Als Politiker im Bereich der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik sollten wir uns herausgefordert fühlen, wenn der slowakische Innenminister sagt: „Die Slowakei will keine Muslime aufnehmen“ und wenn der ungarische Ministerpräsident sein Land in die historische Tradition stellt, Bollwerk des christlichen Abendlandes zu sein. Dies sind Sichtweisen, die eine gewisse nationale Prägung zum Ausdruck bringen. Wenn wir Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ernst nehmen, dann müssen wir die Herausforderung annehmen, in einen Dialog über die Frage einzutreten, wie wir bei so unterschiedlichen nationalen Prägungen gewissermaßen zu einem europäischen Gemeinwohlbegriff kommen können.
Ich glaube, der dogmatische Verweis auf die Grundwerte der Europäischen Union allein löst dieses Problem nicht. Der Gedanke der Schaffung gemeinsamer kultureller Identitäten im vereinten Europa und unter den Mitgliedstaaten hat schon im Review-Prozess des Auswärtigen Amtes eine Rolle gespielt. Insofern wünsche ich mir durchaus, dass wir auch hier, bei dieser Frage, Dialogformen und -möglichkeiten organisieren, die das Ganze nicht allein zu einer Frage von Mehrheit oder Minderheit, sondern zu einer Frage der kulturellen Verständigung machen.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Martin Rabanus das Wort.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/5897072 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 128 |
| Tagesordnungspunkt | Berichte zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik |