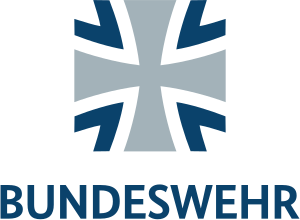Norbert Lammert - Weiterentwicklung der transatlantischen Beziehungen
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich würde gerne einige Bemerkungen machen, die über den Text des Antrages von CDU/CSU und SPD hinausgehen. Dazu gehört am Beginn das Eingeständnis, dass die transatlantischen Beziehungen und namentlich auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen nicht frei von mancher Befremdung und auch manchen Differenzen sind.
Aus europäischer und deutscher Sicht spielt dabei die Entwicklungsgeschichte des Irakkriegs mit den fatalen Folgen einer Destabilisierung der ganzen Nahostregion eine erhebliche Rolle. Die NSA-Überwachungsaktivitäten haben uns empört, jedenfalls so lange, bis der BND bei ganz ähnlichen Aktivitäten erwischt wurde.
(Lachen bei Abgeordneten der LINKEN)
Die inzwischen sehr starke ideologische Aufladung des politischen Systems in den USA mit einer scharfen Polarisierung der Parteien im amerikanischen Kongress befremdet uns. Sie geschieht ausgerechnet in dem Land, das uns Deutschen die Demokratie, die Bedeutung von Checks and Balances und die zentrale Bedeutung, einen Kompromiss zu finden, maßgeblich beigebracht hat.
Wir beobachten zusammen mit vielen Amerikanern im derzeitigen Präsidentschaftsvorwahlkampf eine Art Verwahrlosung der politischen Sitten. Gelegentlich geht jedenfalls mir die Frage durch den Kopf, ob die viel zitierte Wertegemeinschaft auf Donald Trump noch zutrifft. Die gesellschaftliche und politische Vorbildrolle, die die USA über lange Nachkriegsjahrzehnte gerade in Deutschland gehabt hat, ist jedenfalls deutlich getrübt.
Fairerweise wird man allerdings auch sagen müssen, dass es aus US-amerikanischer Sicht ebenfalls einiges an Befremdung und Kritik gibt, was Europa und namentlich Deutschland angeht. Die Amerikaner können bis heute ein außen- und sicherheitspolitisch kohärentes Konzept Europas, in dem es selber Verantwortung für seine Sicherheit übernimmt, nicht erkennen. Auch wehren sie sich – teilweise nachvollziehbar, teilweise nicht – gegen erhebliche Vorwürfe, die ihnen gelegentlich wegen ihrer Polizistenrolle gemacht werden, die sie in vielen Regionen ausüben, während sie gleichzeitig für europäische Sicherheitsinteressen einspringen müssen.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der CDU/CSU)
Wir sind zwar gelegentlich befremdet und halten das enorme amerikanische militärische Potenzial und seinen Einsatz für suspekt, aber wenn dann die sechste Flotte der Vereinigten Staaten von Amerika vor der östlichen Mittelmeerküste patrouilliert und Präsenz zeigt und Einsätze auch gegen den IS fliegt, ist uns dies ganz recht. Gelegentlich ist in dieser Debatte eine gewisse Heuchelei festzustellen.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Namentlich auch die deutsche sicherheits- und bündnispolitische Zuverlässigkeit ist jedenfalls manchmal von den Amerikanern hinterfragt worden, nicht aktuell, aber in der Rückbetrachtung des letzten Jahrzehnts. Die Untätigkeit und Unwilligkeit der Europäer, die USA, die immerhin 70 Prozent des Verteidigungsbudgets der NATO finanzieren, gelegentlich auch zu entlasten, führt jedenfalls zu gewissen Missstimmungen in den USA. Das erstreckt sich aus der amerikanischen Sicht auch auf die Unfähigkeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion, den Euro zu stabilisieren und damit Ansteckungsgefahren für das globale Finanzsystem einzudämmen. Das führt zu dem nicht sehr schmeichelhaften politischen Attest, dass die Europäer selbst nicht in der Lage seien, sich zu organisieren.
So sind die transatlantischen Beziehungen Mitte des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts keineswegs frei von Belastungen und Vorhaltungen. In Deutschland ist deshalb in manchen Debatten – wir werden das zugeben müssen – auch gelegentlich ein Antiamerikanismus festzustellen. Umgekehrt ist in den USA ein zunehmendes Desinteresse an Europa festzustellen mit einer deutlicheren Hinwendung zum asiatisch-pazifischen Raum.
All dies vorausgeschickt und dessen unbenommen bleibt richtig, dass es keine andere so eng verbundene Staatengemeinschaft gibt wie die Europas und der Vereinigten Staaten von Amerika,
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
und zwar historisch, wirtschaftlich, zivilisatorisch, kulturell und mit den enormen Errungenschaften der beiden atlantischen Revolutionen von 1776 und 1789 mit den Prinzipien von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Menschenrechten und Marktwirtschaft. Das hat der deutsche Historiker Heinrich August Winkler das normative Projekt des Westens genannt.
Ja, die Praxis mit ihren Unvollkommenheiten, mit ihren Defiziten, mit ihren Ungerechtigkeiten und auch gelegentlich mit den Verletzungen dieser Prinzipien entsprach und entspricht nicht durchweg diesem normativen Projekt. Aber die Grundrechtserklärung von Virginia 1776 und die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 sind und bleiben einzigartige Errungenschaften, auf denen die Staatswesen in Europa und in den USA und unser gemeinsames Gesellschaftssystem des Westens nach wie vor aufbauen.
Diese Errungenschaften finden sich nicht in einem eurasischen Modell des russischen Präsidenten Putin. Diese finden sich nicht in einem staatskapitalistischen System mit einem kommunistischen Überbau in China. Diese finden sich nicht in islamischen Staaten. Diese finden sich nicht in all den anderen Staaten autokratischer oder diktatorischer Provenienz, sondern diese finden sich hier.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Wer auch immer deshalb die Frage – auch aufgrund gelegentlich auftauchender Kritik – nach einem anderen Partner, nach einem anderen Alliierten, mit dem wir in Europa unsere Werte und beständigen Interessen verfolgen können, auch nur unterschwellig stellt, der muss passen. Wer auch immer die Frage hinzufügt, ob Europa eines Partners auf der anderen Seite des Atlantiks bedarf, dem antworte ich mit einem klaren Ja.
In einer gefährlichen Welt, in der einige Kräfte ihr Unwesen treiben, die nicht verhandlungsfähig und nicht verhandlungsbereit sind, mit den diversen Konflikten und auch neuen sogenannten hybriden Kriegen an der Peripherie Europas, bleibt eine transatlantische Rückversicherung für Europa von zentraler Bedeutung.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Eine solche Rückversicherung verlangt von uns Europäern und auch von uns Deutschen aber auch einen Beitrag, der sich gewiss auf diplomatische, humanitäre, wirtschaftliche und entwicklungspolitische Anstrengungen erstrecken muss, der sich aber eben auch auf die Abschreckungsfähigkeit der NATO und die Einsatz- und Bündnisfähigkeit der Bundeswehr erstrecken muss.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Dieser Satz ist in der deutschen Öffentlichkeit nicht sehr populär, aber er gehört in diese Debatte. Man kann nicht nach einer globalen Ordnung rufen, die uns möglichst viel Chaos, Anarchie und menschliches Leid erspart und dann der uns aus westlicher Sicht zwar nicht mehr singulären, aber jedenfalls immer noch dominant erscheinenden Ordnungsmacht, nämlich den USA, die Unterstützung verweigern. Dies ist widersprüchlich.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU – Volker Kauder [CDU/CSU]: Sehr richtig!)
All denjenigen – möglicherweise auch in diesem Hause –, die bei diesem Satz zögern oder sogar Zweifel an seiner Richtigkeit erwecken, stelle ich die Frage: Welche andere Ordnungsmacht hätten Sie denn lieber?
(Volker Kauder [CDU/CSU]: Russland! – Gegenruf des Abg. Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE]: Ist das langweilig, Herr Kauder!)
Über die Sicherheitsaspekte, die ich bisher erwähnt habe, hinaus werden sich Europa und die USA mit massiven globalen Verschiebungen beschäftigen müssen. Der Anteil der Bevölkerung dieser beiden Kontinente bzw. Teilkontinente an der Weltbevölkerung ist in den letzten 40 Jahren auf 10 Prozent zurückgegangen, und er wird weiter schrumpfen. Der gemeinsame Anteil der USA und Europas am globalen Bruttonationaleinkommen ist in dieser Zeit von 60 Prozent auf 45 Prozent zurückgegangen, und er wird weiter abnehmen. Der Anteil dieser beiden Kontinente bzw. Teilkontinente am Welthandel ist von rund 30 Prozent auf inzwischen 20 Prozent zurückgegangen, und er wird weiter abnehmen. Das ist ein Indiz dafür, dass wir es mit globalen tektonischen Verschiebungen zu tun haben. Die Welt wird multipolarer mit dynamisch aufsteigenden Regionen. Darüber darf sich der atlantische Raum mit seinen politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und auch technischen Errungenschaften nicht marginalisieren.
Schließlich sind die globalen Herausforderungen wie der Klimawandel sowie die Bekämpfung von Terrorismus, organisierter Kriminalität, Pandemien und Steuerbetrug mit keiner anderen Macht zu lösen als mit den USA. Ohne das Gewicht der USA an der europäischen Seite werden diese Probleme nicht bewältigt werden können.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Auf die aktuellen zentralen Probleme und kritischen Einwände zu dem Projekt, das uns am meisten in den transatlantischen Beziehungen beschäftigt – das ist das Freihandelsabkommen TTIP –, will ich nur wenige Worte verwenden, nicht aus Geringschätzung gegenüber den Problemen und kritischen Einwendungen, sondern aus Zeitgründen. Mir sind – genauso wie Ihnen und weiten Teilen der Bevölkerung – alle diese Probleme bewusst. Ich will diese gar nicht in Abrede stellen. Aber ich möchte auf drei Aspekte in der Debatte über dieses Freihandelsabkommen aufmerksam machen.
Erstens. Wer mit einem sehr skeptischen Blick auf die teilweise anarchische Entwicklung der Globalisierung schaut, wird für Leitplanken und Verkehrsregeln im weltweiten Handel eintreten und sich die Frage stellen müssen, ob in diesem Sinne TTIP nicht eine Chance ist.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Zweitens. Wenn sich die Europäer und die Amerikaner nicht auf ein solches Freihandelsabkommen einigen – das kann passieren –, dann stellt sich die Frage, wer stattdessen die Spielregeln global bestimmen wird,
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
und das vor dem Hintergrund der Dynamik anderer Weltregionen, die mit Sicherheit zu Ergebnissen kämen, die europäischen Standards und europäischen Vorstellungen nicht entsprechen würden. Die augenblickliche Debatte, die wir zur Lage der europäischen und deutschen Stahlindustrie führen, ist ein leichtes Indiz dafür, was es bedeuten würde, wenn andere die Leitplanken und Verkehrsregeln im weltweiten Handel bestimmen würden.
Drittens. Ist TTIP über seine ökonomische Bedeutung hinaus nicht auch von einem erheblichen strategischen Stellenwert im Verhältnis von Europa zu den USA, oder wie würden sich die transatlantischen Beziehungen in ihrer Qualität entwickeln, wenn TTIP scheitern sollte?
Diese drei Fragen möchte ich über die ziemlich niveaulose Debatte über das Chlorhähnchen hinaus stärker öffentlich debattiert haben.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Mein Plädoyer für eine Revitalisierung der transatlantischen Beziehungen folgt keinem Verständnis eines subalternen oder bedenken- und kritiklosen Verhältnisses Europas zu den USA, sondern einer sehr nüchternen Sicht auf unsere beständigen europäischen und deutschen Interessen, getreu einem Zitat des ehemaligen britischen Premierministers Lord Palmerston aus dem 19. Jahrhundert, der einmal sinngemäß, bezogen auf England, gesagt hat, dass England weder ewige Freunde noch ewige Feinde, sondern nur beständige Interessen hat. Die beständigen Interessen Deutschlands und Europas gelten einem guten transatlantischen Verhältnis.
Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Stefan Liebich ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke.
(Beifall bei der LINKEN)
| Quelle | Deutscher Bundestag, Nutzungsbedingungen |
| Quellenangabe | Deutscher Bundestag via Open Parliament TV |
| Abgerufen von | http://dbtg.tv/fvid/6755793 |
| Wahlperiode | 18 |
| Sitzung | 165 |
| Tagesordnungspunkt | Weiterentwicklung der transatlantischen Beziehungen |